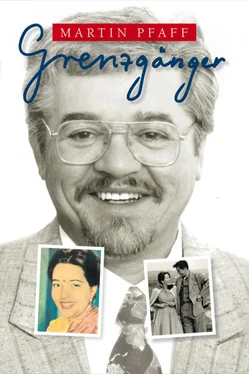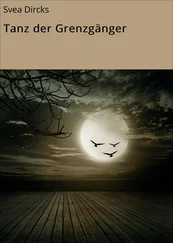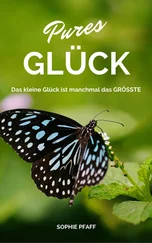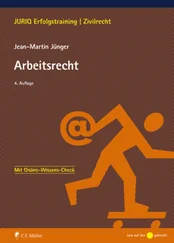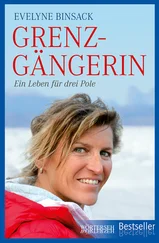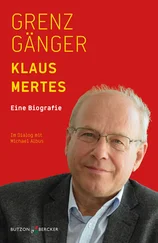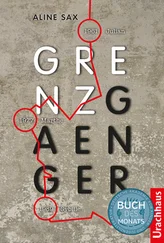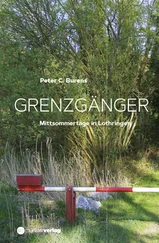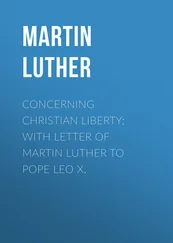Auf der anderen Seite des Weges beginnt ein weiteres Maisfeld. Wie ich später erfahren werde, ist dies eine der Stellen in dem Raum zwischen Pusztasomorja und dem österreichischen Andau, an denen es noch keine Grenzzäune gibt, die ein unerlaubtes Überqueren der Grenze erschweren.
Wir schleichen uns einige hundert Meter weiter durch die Felder. Endlich hellt sich die Miene meines Vaters auf: „Wir haben es geschafft! Wir sind über die Grenze gekommen! Heute Abend sind wir in Wien!“
Mir fällt ein Stein vom Herzen. Meine aufgestaute Neugier drängt sich aber jetzt erst recht heraus: „Vater, warum gibt es diese Grenze? Warum können wir nicht einfach hingehen, wohin wir wollen?“
„Martin, Grenzen hat es immer schon gegeben. Sie zeigen an, wo ein Land aufhört und ein anderes beginnt. Es ist wie bei den Äckern zu Hause: Jeder Bauer muss doch wissen, was ihm gehört und worüber er entscheiden kann, und was dem anderen gehört!“
„Ja, aber da geht es doch nur um Äcker! Menschen dürfen doch auch die Grenzen von einem Acker zum anderen überschreiten und auf den Feldwegen dorthin gehen, wohin sie wollen.“
Er lächelt: „Ja, aber bei Landesgrenzen ist es etwas anderes. Manche Länder – wie hier Ungarn – wollen nicht, dass ihre Einwohner mir nichts, dir nichts in ein anderes Land gehen können.“
„Warum nicht?“
„Weil sie Angst haben, dass die Menschen nicht zurückkommen. Dann haben sie niemanden, der hier arbeiten und leben will.“
„Vater, machen das alle Länder so?“
„Nein, Martin, manche Länder erlauben ihren Bürgern, frei dorthin zu reisen, wohin sie wollen.“
„Ja, aber haben die denn keine Angst, dass die Leute dann nicht wiederkommen?“
„Nein, manche sind klüger. Sie wissen: Wenn die Menschen immer frei aus- und wieder einreisen können, haben sie keinen Grund, ganz wegzugehen …“
Den Gang über diese „erste“ Grenze erlebte ich noch passiv, in Anpassung an die Entscheidungen meines Vaters: Er – nicht ich – wollte, dass ich in Wien zur Schule gehen sollte. Mir selbst überlassen, wäre ich wohl zu dem Entschluss gekommen, in der vertrauten, tristen Umgebung zu bleiben: Trotz allem war Tevel meine erste Heimat. Hier lebten meine Großeltern, meine Brüder, meine Verwandten. Der Weg nach Wien erschien mir als Weg in die Fremde.
Nicht bewusst war mir, dem Siebenjährigen, dass ich meine Außenwelt in dem donauschwäbischen Dorf damals auch als Fremdheit empfand. Das dumpfe Gefühl des Unglücklichseins war zum Dauerzustand geworden. Das Leben erschien mir grau in grau gezeichnet.
Diese Einstellung wurde durch Ereignisse hervorgerufen, über die ich – schon gar nicht als Kind – keinerlei Kontrolle ausüben konnte.
2. Ungarn: Wehe den Besiegten!
(1939 bis 1947)
Zwei Jahre zuvor: Der 31. Dezember 1944 erschütterte wie ein Paukenschlag mein Leben als Fünfjähriger, er warf einen dunklen Schatten voraus – wohl für den Rest meines Lebens. Dabei war mein Leben auch bis dahin keineswegs idyllisch verlaufen: Zu sehr drangen die Boten des Krieges in unser scheinbar friedliches und verschlafenes donauschwäbisches Dorf.
Als Kleinkind nahm ich diese Bedrohungen nicht in ihrer ganzen Bedeutung wahr. Aber die Anspannung der Erwachsenen habe ich sehr wohl registriert. Außerdem flogen von Zeit zu Zeit Flugzeuge über unser Dorf, ohne es jedoch anzugreifen.
Als mein Vater 1944 nach Fünfkirchen in ein Wehrertüchtigungslager einrückte, wollte er meine Mutter und uns drei – ich war fünf Jahre, mein Bruder Mathias drei und mein jüngster Bruder Anton zwei Jahre alt – nachkommen lassen. Hierfür schickte er einen Pferdewagen, gedeckt mit einer großen Plane, abwechselnd gelenkt von zwei Kutschern. Meine Mutter weigerte sich jedoch, allein mit uns dreien mitzufahren. Jedoch waren ihre Schwägerin und deren zwei Schwestern bereit, mitzukommen. Nur widerwillig schlossen sich meine zwei jungen Kusinen an, Mari (Maria), dreizehn Jahre alt, und Kathi (Katharina), zwölf Jahre alt. „Wir wollten einfach nicht von zu Hause weg. Auch die Großeltern wollten nicht mit!“, würde mir Kathi später berichten.
In Fünfkirchen wurden wir von einer Bekannten aus Tevel aufgenommen, die hierher geheiratet hatte. Obwohl sie selbst nur ein kleines Häuschen besaß, hat sie uns beherbergt. Sie hatte zwei Söhne. Ihr Mann war beim Militär.
Zusammen mit den Kusinen gingen wir Geschwister einmal auf die Suche nach unserem Vater. Als wir ihn endlich auf dem Truppenübungsplatz bei der Kaserne fanden, war er besorgt: „Was wollt ihr hier? Es kann jederzeit einen Luftangriff auf die Kaserne geben! Geht schnell zurück zur Mutter!“
Und in der Tat. Meine Erinnerung an die folgenden Ereignisse ist bis heute lebendig: Als wir auf dem Rückweg sind, heulen die Sirenen auf. Wir wissen, dass es ein Fliegeralarm ist. Zusammen mit anderen Menschen laufen und laufen wir. Schließlich landen wir im Keller der großen Kirche, auch „Bischofskeller“ genannt. Als wir zu unseren Müttern zurückkommen, werden wir kräftig ausgeschimpft und auf die Gefahren des Luftangriffs hingewiesen.
Szenen weiterer Luftangriffe auf Fünfkirchen sitzen tief in meinem Gedächtnis: wie wir beim Heulen der Sirenen die Fenster und Türen des Hauses aufreißen, um eine Beschädigung durch Druckwellen zu verhindern, und uns auf den Boden legen. Und wie wir zusammenzucken, wenn die Bombeneinschläge näher kommen. Oft bilden die Erwachsenen einen Kreis um uns Kinder, im Glauben, uns so im Falle eines Bombenangriffs besser schützen zu können. Dazu Kathi: „Offenbar galt die Vorstellung: Wenn wir sterben, sterben wir zusammen!“
Mein Vater wird an die russische Front versetzt, wie viele andere Donauschwaben aus Ungarn auch. Meine Mutter, wir drei Kinder sowie die anderen Verwandten kehren nach Tevel zurück, von den Großeltern freudig begrüßt.
Bald werden die Meldungen über den Vormarsch der sowjetischen Armee eindringlicher. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis sie Tevel erreichen werden. Die Angst aller – vor allem der Frauen – nimmt zu.
Mein Vater schreibt meiner Mutter, sie solle mit uns Kindern in den Westen gehen, um vor den Russen zu fliehen. Wiederum weigert sich meine Mutter, allein mit drei kleinen Kindern wegzuziehen. Die anderen Verwandten sagen: „Wir gehen nicht mehr mit! Wir bleiben hier!“ Die letzten reisewilligen Teveler fliehen Richtung Högyész-Szakály, zur Eisenbahn. Sie erwischen den letzten Zug, der in Richtung Westen geht. Dann kommt die Nachricht: „Szakály wird von den Russen beschossen! Die Zugverbindung ist unterbrochen!“
Unter den Tevelern, denen die Flucht gerade noch gelang, sind Freunde meines Vaters wie Herr Bless. Diese Freundschaften sollten ein Leben lang halten.
In unserem Dorf werden die Russen jederzeit erwartet: Als sie fast da sind, verstecken wir uns zusammen mit anderen Bewohnern in kellerartigen Höhlen am Dorfrand bei der „Schanze“, einer Befestigung aus der Zeit der Türkenkriege. Zweiundsiebzig Personen finden hier Zuflucht: ältere Männer, Frauen und Kinder. Die Eingänge werden mit Maisstängeln abgedeckt, sodass sie von außen nicht eingesehen werden können. Ich erinnere mich gut an das Weinen der Kleinkinder und die hektischen Bemühungen der Erwachsenen, sie zur Ruhe zu bringen. Beim Vorbeigehen konnten solche Laute wahrgenommen werden.
Mein Bruder Matheis (Mathias) weint und kann nicht beruhigt werden; er vermisst sein Lieblingsspielzeug, das in unserem nahegelegenen Haus in der Eile zurückgelassen worden war. Er bedrängt unsere Mutter, dieses mit ihm zusammen zu holen. Sie verlassen die Höhle. Er weint, bis die ersten Schüsse zu hören sind. Danach ist er stumm, schmiegt sich an unsere Mutter. Sie kehren sofort um. Mein kleiner Bruder Toni ist leichter zu beruhigen: Versteht er noch nicht, worum es geht?
Читать дальше