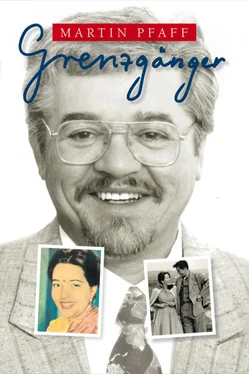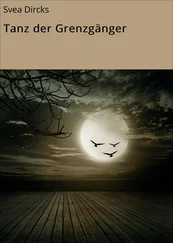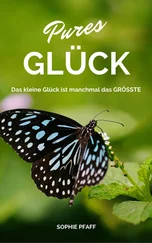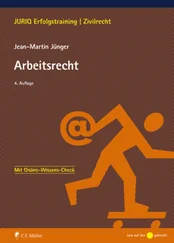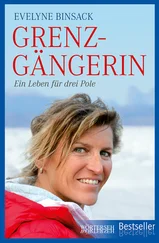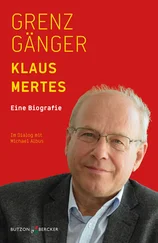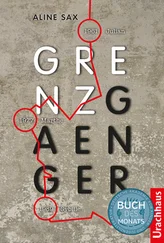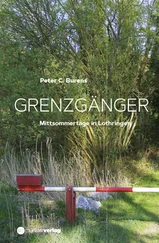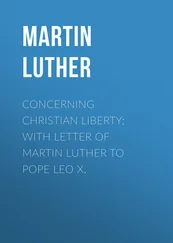Meine weitere Erinnerung bleibt verschwommen. Nach dem Abschied von meiner Mutter überkam mich eine panische Angst und eine unendliche Traurigkeit: Ich ahnte, ohne es tatsächlich zu wissen, dass die Mutter sehr lange weg sein würde. Woher diese dunkle Vorahnung kam, weiß ich nicht. Im Leben habe ich einige Male solche Vorahnungen gehabt – für Gutes und für Schlechtes.
Ob ich diesen Tag jemals vergessen werde? Die Unsicherheit, die Angst, einen geliebten Menschen – das Zentrum meiner Welt – zu verlieren, werden sie mich mein ganzes Leben lang begleiten? Ich verspürte eine große emotionale Leere, eine Traurigkeit, die nicht enden wollte.
Ich frage mich heute, wie es meinen Brüdern ergangen ist, waren sie doch deutlich jünger und konnten den Verlust der Mutter noch weniger verkraften. Oder haben sie das alles gar nicht so richtig mitbekommen?
In meiner Verzweiflung rannte ich in den Garten, kroch tief in einen Heuschober hinein. Als ob ich mich vor der grausamen Welt verstecken wollte, Schutz und Geborgenheit suchend. Ich schlief ein und kam erst am Mittag des nächsten Tages heraus, zur großen Erleichterung meiner fassungslosen Großeltern: Sie hatten überall nach mir gesucht und das Schlimmste befürchtet.
Für meine Großeltern war durch die Verschleppung meiner Mutter eine Welt zusammengebrochen: Hier standen sie mit drei kleinen Kindern, ohne deren Mutter und ohne deren Vater, der sich noch bei der Armee weiter im Westen befand. Nichts hatte sie auf eine solche Tragödie vorbereitet. Und sie waren sich keiner Handlung bewusst, die eine solche Ungerechtigkeit rechtfertigen würde.
Die Stimmung in Tevel war verändert, die Gesichter der Menschen gezeichnet. Die Augen der Alten blickten verzweifelt aus bleichen Gesichtern. In einer Gemeinschaft, in der fast nur noch Alte und Kinder übrig bleiben, gehen Wärme und Hoffnung verloren. Es war sehr still, totenstill im Ort.
Es sollte jedoch noch schlimmer kommen. Die Russen sammelten Kühe und Ochsen ein, wohl als Essensreserve, und ließen sie hinter der vorrückenden Armee hertreiben. Eines Tages kam wieder eine kleine Herde mit Treibern zu unserem Hof. Auch wir mussten eine Kuh abgeben. Mein Großvater wurde gezwungen, sich als Viehtreiber anzuschließen, bis in die Gegend von Baja. Von dort ließ man ihn zu Fuß nach Hause gehen – im kalten Januar bei ca. zwanzig Grad minus.
Zu Hause war die Situation kritisch geworden: Meine Großmutter, die einzige Erwachsene, lag krank im Bett, mit drei Kindern im Haus. Da hieß es immer für meine zwölfjährige Kusine: „Mari! Aufstehen! Geh zu Kleene Mathese (unser schwäbischer Hausname), Kinder wecken und anziehen, Feuer machen, Wasser beim Ziehbrunnen schöpfen!“ Im tiefen Schnee war ein Pfad geschaufelt, auf dem die Kühe und Ochsen zur Tränke am Brunnen gelangen konnten. Mari erzählte später: „Ich habe geschöpft, geschöpft. Den Schöpfer immer wieder hoch und runter, bis die Kühe genug gesoffen hatten. Und vis-à-vis bei den Drehers (so der Hausname): Ein noch kleineres Kind hatte dieselbe Pflicht wahrzunehmen! Es war eine harte Zeit. Wir Kinder mussten uns wie Erwachsene verhalten. Meine Großmutter hat die Kühe gemolken. Aber für die Milch gab es keinen Absatz, weil die Organisation des Milchvereins zusammengebrochen war und wir hatten die von den Hühnern gelegten Eier.“ So entstand die perverse Situation der Übergangszeit – eine Zeit großer seelischer Not gekoppelt mit einem Überschuss an Lebensmitteln. Dies sollte sich sehr bald ändern.
Die Alten und die wenigen verbliebenen Jüngeren organisierten sich neu: die Arbeit in den Stallungen, auf den Äckern, die Sorge um Haus, Hof, Vieh und um die Kinder. Sie mobilisierten Kräfte, die sie früher nicht mal bei sich geahnt hätten. Denn es ging um das Überleben von Kindern, Familie und Gemeinschaft.
In der Geschichte unserer Vorfahren gab es mehrfach große Entbehrungen und individuelles Leid. Aber wohl kaum etwas Vergleichbares.
Wie war es überhaupt zur Ansiedlung meiner deutschen Vorfahren in Ungarn gekommen?
Mich haben zeitlebens Ahnentafeln nie interessiert, ganz im Gegensatz zu meinem Vater: Er leitete seine Identität viel mehr aus der Vorgeschichte unserer Familie ab. Ich dagegen war an Taten interessiert, durch die ich meine Identität selbst zu definieren trachtete. „Ich bin, was ich tue!“, entspricht eher meinem Credo als: „Ich bin der Nachfahre von so und so!“
Der Stammbaum der Familie Pfaff ist seit 1713 dokumentiert, in Urkunden, Kirchenbüchern und Ähnlichem nachgewiesen. Mein Vorfahre Andreas Pfaff war nachweislich im Jahr 1713 aus Littenweiler (in den Pfarrbüchern damals als Leutenwyller bezeichnet) bei Freiburg im Schwarzwald zusammen mit Frau und Kindern nach Ungarn ausgewandert. Wie andere Donauschwaben fuhren sie auf großen Flößen (später „Ulmer Schachteln“ genannt) die Donau hinunter. Die Anlegestellen des Floßes, die Vereinbarungen mit dem Grundherrn Graf Döry über die Grundausstattung des Gebiets des späteren Orts Tevel sind bekannt.
Weniger klar sind die Beweggründe der Auswanderer: Überbevölkerung, Folgen der Kriege, Hoffnung auf ein besseres Leben in der neuen Heimat, oder ein bisschen von allem? Sie wussten, dass sie nicht in ein Paradies auf Erden ziehen würden. Weite Landstriche waren im Zuge der Türkenkriege zerstört worden, das Land verödet, eine Infrastruktur kaum vorhanden.
Die Zusagen des ungarischen Grundherrn Döry erwiesen sich als Illusion: Das für die Feldarbeit versprochene Vieh wurde nie geliefert. Die bäuerliche Arbeit auf den Feldern musste per Hand erledigt werden. Sogar die zugesagten Häuser fehlten: Die ersten Einwanderer mussten in Erdlöchern wohnen, bis sie einfache Häuser bauten. Allerdings besaßen sie Privilegien und Freiheiten: Die ersten drei Jahre waren steuerfrei. Und sie waren keine Leibeigenen, konnten also weiterziehen, wenn sie wollten. Viele taten dies. Andere kehrten enttäuscht, teils auch krank von Entbehrungen und Not, in die südwestdeutsche Heimat zurück. Ein vielfach verwendetes Zitat fasst diese Zeit in bemerkenswert gebündelter Form zusammen: „Die Ersten fanden den Tod, die Zweiten die Not, erst die Dritten das Brot.“
Zweieinhalb Jahrhunderte später waren aus den steinigen Äckern so etwas wie „blühende Landschaften“ geworden. Wer sich diese mit den Augen des heutigen Betrachters vorstellen will, sollte sich die Landschaften der Amish oder der Pennsylvania Dutch unweit von Philadelphia, Pennsylvania, in Erinnerung rufen. Dort leben einfache, in der Religion verwurzelte Menschen, fleißig und genügsam, ehrlich bis zur Peinlichkeit.
Die Häuser in Tevel bestanden aus einem Wohnteil, im rechten Winkel dazu Stall, Scheune und ein Misthaufen. Als Teil des Wohngebäudes ein überdeckter Gang. Ein Brunnen. Alles war schmuck, sauber angeordnet und durch einen Zaun nebst großem Tor von der Straße abgegrenzt. An der äußeren, straßenseitigen Ecke unseres Hauses (s’Kleene Mathese) befand sich eine Ecce-Homo-Statue aus Stein, ein gefesselter Christus mit weitem Umhang.
Hervorgehoben, da auf Hügeln stehend, die Kirche, die Schanz sowie Weingärten auf den Hügeln am Rande des Dorfes. Dazu viele Bäume, meist von mittlerer Größe, auch einige hochgewachsene Pappeln.
Neben den Bauernhäusern gab es etliche kleinere Gebäude der „Kleinhäusler“. Neben dem katholischen Friedhof auch ein Judenfriedhof. Ein Dorf wie viele andere, die von Schwaben gegründet und aufgebaut worden waren.
Unsere Vertreibung aus Tevel erfolgte in mehreren Etappen. Der 25. April 1945 ist mir lebhaft in Erinnerung: An diesem Tag, weniger als vier Monate nach der Verschleppung meiner Mutter, erklingt die Trommel des Kleinrichters, eines nachgeordneten Gemeindeangestellten. Aus dem Haus geeilt, hören wir seine Botschaft: „Alle Dorfbewohner müssen bis halb zehn in der Wiese zum Schlagbruch mit kleinem Gepäck erscheinen. Das Dorf ist umstellt. Wer fliehen will, wird erschossen! Die Häuser sollen unverschlossen bleiben!“
Читать дальше