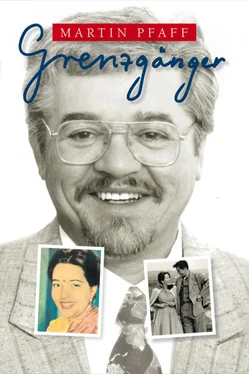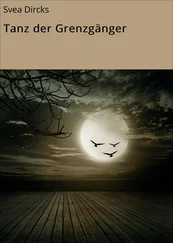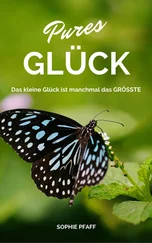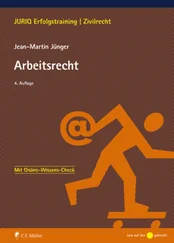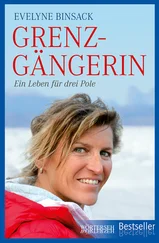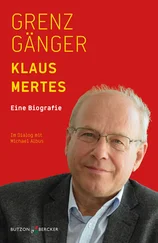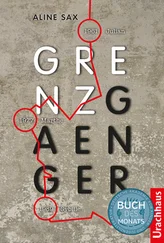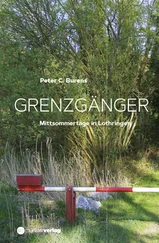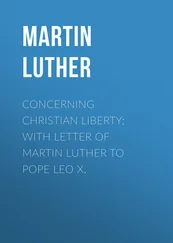Die heranrückenden Russen verfolgen die letzten deutschen Einheiten, die sich der Hauptstraße entlang zurückziehen. Sie beschießen auch den Schanz-Hügel. Nach dem Krieg werden vier Gräber mit russischen Gefallenen dort gefunden. Diese werden später exhumiert und in ihre Heimat überführt.
Wie es dazu kommt, dass wir schließlich die Höhlen verlassen können, weiß ich nicht. Laut Teveler Heimatbuch werden die Russen vom Schuldirektor mit einer weißen Fahne begrüßt. Die Lage beruhigt sich schnell. Nur ein Gebäude geht in Flammen auf: das „Kastell“, in dem die Russen Waffen gefunden haben. Die Teveler werden zu Schanzarbeiten verpflichtet.
Mein Großvater hat vor dem Eintreffen der Russen die Weinfässer Eimer für Eimer auf den Misthaufen geleert, um Alkoholexzesse zu verhindern. Meine Großmutter mütterlicherseits muss für die russischen Soldaten Gänse und Hühner schlachten und zum Essen zubereiten.
Meine Großmutter väterlicherseits legt sich ins Bett und gibt vor, krank zu sein. Sie versteckt meine Mutter hinter sich unter großen Daunendecken. Vorher hatte sie mithilfe von Kohle ihr Gesicht altern lassen und ihr ein Kopftuch umgebunden, um sie hässlich zu machen. Glücklicherweise war ein Offizier bei uns einquartiert worden und es kam zu keinen Übergriffen auf die Frauen. Er wohnte in der unteren Stube. Meine Kusine Mari erzählte später: „Die Soldaten hatten kaum freien Lauf: Sie wären hart bestraft worden, wenn sie den Dorfbewohnern etwas angetan hätten.“
Dass es dennoch Übergriffe gab, berichtete meine Kusine Kathi: „Meine Mutter, mit euch dreien und uns zwei Kindern, meine Tante mit ihrer kleinen Tochter und meine Großeltern mütterlicherseits versteckten uns in einem Haus in der Helistadt – so hieß dieser Teil Tevels. Dieses Haus war schwer zugänglich, weil es in einer Nebenstraße, einer Art Sackgasse, gelegen war. Auf einmal kamen die Russen auch in diese Straße. Ein Russe kam in das Haus, in dem wir uns auf Strohsäcken am Boden zum Schlafen hingelegt hatten. Meine Mutter lag hinter mir und gab keinen Laut von sich. Als ich den Russen sah, hab ich geschrien. Er wollte auf mich zukommen und mich beruhigen. ‚Ich habe auch Kinder‘, sagte er. Auf einmal kam ein Offizier herein und sie gingen weiter. Ich weiß nicht mehr, wie viele Nächte ich von dem Russen geträumt habe … geträumt und geweint. In dieser Nacht haben sie drei bis vier Häuser weiter eine Frau vergewaltigt. Ja, so etwas hat es schon gegeben. Natürlich!“
Und sie fügte hinzu: „In unserem neu gebauten Stall gab es ein Versteck in einer Ecke am Heuboden. Hier hatten sich die Frauen einen Schlafplatz gemacht. Und wenn es hieß: ‚Die Russen kommen!‘, sind die Frauen nach oben geklettert. Die Leiter wurde wieder weggenommen.
Wir Kinder blieben mit der Großmutter unten. Meine Schwester Mari war körperlich schon sehr früh entwickelt. Einmal stand ein Russe vor ihr und hat sie angeschaut. Aber die Großmutter schrie ihn an: ‚Nichts da! Weg da!‘ Darauf drehte er sich um und verließ den Raum. Und von dem Tag an musste Mari auch mit den jungen Frauen auf den Heuboden. Es war schlimm.“
Neugierig wie Kinder sind, machen wir uns bald daran, die Soldaten zu inspizieren. Sie scherzen mit uns, setzen uns ihre Mützen auf, heben uns sogar auf die Rohre der Panzer. Bald haben wir viel Zutrauen zu ihnen und ahnen nicht, was noch auf uns alle zukommen soll.
Am 31. Dezember 1944 hat die trügerische Ruhe ein Ende. Durch Trommelschlag werden die Frauen der Jahrgänge 1915 bis 1926 und die wenigen verbleibenden Männer der Jahrgänge 1900 bis 1927 ins Gemeindehaus von Tevel einbefohlen.
Meine Mutter – Jahrgang 1920 – macht sich ebenfalls auf den Weg, mit meinem Bruder Toni auf dem Arm, Matheis auf der einen Seite und mit mir auf der anderen Seite. Wir halten uns am Rockzipfel fest und befürchten das Schlimmste. Die grauen Wolken und die Kälte des Dezembertages tragen noch dazu bei. Wir haben Angst.
Beim Gemeindehaus angekommen, finden wir viele Menschen vor, hauptsächlich Frauen, mit ihren Kindern im Schlepptau. Ich verstehe nicht alles: Aber es wird klar, dass die vorgeladenen Frauen und Männer zu einem Arbeitsdienst von vierzehn Tagen zum „Maisbrechen“ in die Báczka geschickt werden sollen. So lautet zumindest die offizielle Version.
Ein russischer Soldat, der gebrochen Deutsch und ein wenig Ungarisch spricht, und einer der Teveler – Herr Eppl – nehmen die Personalien der Frauen und Männer auf. Wir ordnen uns in die Warteschlange ein. Der Soldat blickt auf meine Mutter mit uns drei Kindern. Er räuspert sich, schaut auf sein Protokoll, dann wieder zu unserer Mutter und fragt schließlich:
„Sind Sie schwanger?“
„Nein, ich bin nicht schwanger“, antwortet sie.
„Sind Sie sicher, dass Sie nicht schwanger sind?“
„Nein, ich bin wirklich nicht schwanger!“, schießt meine Mutter entrüstet zurück.
Der Soldat blickt sie schweigend an, schüttelt den Kopf und nimmt ihre Personalien auf. Später erst sollte meine Mutter verstehen, worum es dem Mann tatsächlich ging: Schwangere waren von der Order ausgenommen. Dies war aber der Bevölkerung nicht mitgeteilt worden. Angesichts der drei kleinen Kinder hat der Soldat wohl Mitleid empfunden. Er wollte verhindern, dass er unsere Mutter, drei kleine Kinder zurücklassend, zum Arbeitsdienst schicken musste, ohne dabei seine Befehle zu verletzen und sich strafbar zu machen! Solch verschlungene Gedankengänge waren den geradlinigen Donauschwaben fremd und passten insbesondere nicht zu unserer Mutter, die zeitlebens ihre Gedanken geradeheraus sagte, ohne sich allzu sehr um die Konsequenzen zu kümmern.
Die Situation war noch nicht endgültig geklärt, wie mir meine Kusine Kathi Jahre später erzählte: „Ein anderer Soldat, der die Szene beobachtet hatte, mischte sich ein: ‚Diese Frau muss nicht zum Arbeitsdienst!‘ Doch daraufhin haben einige Teveler Frauen zu den Russen gesagt: ‚Die muss mit! Ihr Mann war der Anführer der Volksbündler im Dorf!‘ Damit meinten sie die Organisation der Deutschen in Ungarn, die große Sympathien für Nazideutschland hatten.“
Ihre Beschuldigungen besiegelten das unmittelbare Schicksal meiner Mutter: Sie musste mit zum Arbeitsdienst in der Fremde. Mir gefiel die Situation überhaupt nicht.
„Mutter, geh bitte nicht weg!“
„Ich muss weg, aber es ist ja nicht für sehr lange!“
„Wie lange?“
„Die Soldaten und der Dorfschreiber sagen: für zwei Wochen.“
„Aber das ist doch sehr lange!“
„Ich kann es nicht ändern!“
„Warum musst du weg?“
„Angeblich sollen wir Deutschen bestraft werden, durch Arbeitsdienst beim Abernten der Felder in der Báczka. Das ist wegen des Kriegs im letzten Herbst versäumt worden, so heißt es.“
„Mutter, wofür sollst du bestraft werden?“
„Wir sollen bestraft werden, weil wir Deutsche sind!“
„Ist das etwas Schlimmes?“
„Nein, aber das verstehst du noch nicht.“
„Warum nicht?“
„Weil du noch zu klein bist!“
Am nächsten Tag wurden über zweihundert Personen in Ochsenwagen – mit Gepäck und Verpflegung für vierzehn Tage – in die nahe gelegene Kleinstadt Szekszárd ins Sammellager für das Komitat gebracht. Am 9. Januar 1945 ging es in Viehwaggons ins Arbeitslager Arbyum in der Ukraine: Statt der vierzehn Tage sollten es fünf Jahre werden.
Die Arbeit in Kohlegruben unter Tage – wie bei meiner Mutter – oder bei Bauarbeiten oder in Kolchosen war schwer, die Verpflegung und Unterkunft mangelhaft. Ein Drittel der Frauen und Männer schafften es nicht zurück: Sie liegen heute noch in fremder Erde begraben.
Was in den Köpfen und Herzen der Menschen vorging, als sie den Betrug bemerkten, ist mir nicht bekannt: Meine Mutter erzählte später bereitwillig vom Leben im Arbeitslager, sprach aber kaum über ihre Gefühle während des Transports. Es bedarf keiner großen Fantasie, diese zu erraten.
Читать дальше