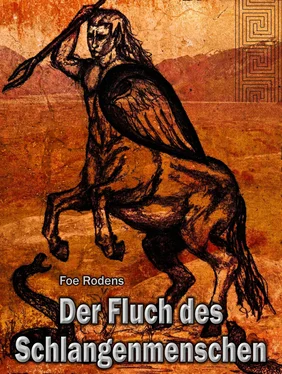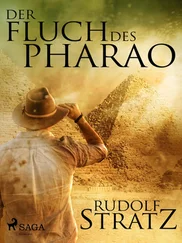„Sobald du in der Stadt bist, bist du außer Gefahr“, beruhigte er sie. „Ihr wollt mich in die Stadt der Menschen bringen? Ihr solltet Euch nicht in Gefahr bringen. Setzt mich doch lieber in der Nähe der Stadt ab, dann könnt ihr ungefährdet wieder verschwinden!“, sprudelte es aus ihr heraus. Sie hatte zwar im ersten Moment furchtbare Angst vor dem Kentauren gehabt, aber er schien doch freundlich zu sein, und sie wollte nicht, dass ihm etwas zustieß.
Xanthyos lachte auf. Das Lachen machte ihn noch sympathischer. Sein langes schwarzes Haar hüpfte und sprang umher, an seinem Mund bildeten sich kaum sichtbare Lachgrübchen. Seine Augen funkelten in der Sonne moosgrün wie Smaragde.
„Nein, nach Šadurru zu gehen, wäre Selbstmord und ich bin noch nicht bereit, zu sterben. Ich werde dich zu Fürst Aireion bringen, dem Herrscher unseres Volkes.“ Die Verachtung, mit der Xanthyos das Wort „Fürst“ aussprach, war nicht zu überhören. Es klang aus seinem Mund wie ein Schimpfwort. Das Lächeln war verschwunden, jetzt funkelten seine Augen vor Wut. „Er und seine Anhänger sind schwach und feige. Sie sind Menschenfreunde. Sie sehen nicht, dass uns nur noch der Krieg Frieden bringen kann.“
„Aber wieso ...“, fragte Temi.
„Ich bin sicher, der Fürst wird dir alles erklären; er wird sich freuen, dich zu sehen“, unterbrach Xanthyos sie unwirsch. Temi schluckte. Es war wohl klüger, jetzt den Mund halten. Sie hatte offenbar einen wunden Punkt berührt und es war besser, den Kentauren nicht weiter reizen. Sonst überlegte er es sich vielleicht anders und hielt sie doch für einen Menschen aus seiner Welt. Das wollte sie nicht riskieren.
„Komm, steig auf“, befahl er ihr, aber mit eher sanfter als herrischer Stimme. „Je schneller wir da sind, desto weniger kann passieren.“ Er hatte sich wieder im Griff.
Kaum saß sie auf seinem Rücken, startete Xanthyos und nach wenigen Sprüngen Anlauf flogen sie regelrecht über die Wiese. Das Gras musste Xanthyos bis zu den Knien, an mancher Stelle fast bis zum Bauch reichen, doch mit kräftigen Sprüngen katapultierte er sich über das Dickicht hinweg. Wenn es ihn behinderte, merkte Temi nichts davon. Von hier oben wirkte die Wiese wie ein wogendes grünes Meer, nicht einmal durchsetzt von Blumen oder kleinen Büschen. Doch Xanthyos hielt nun auf einen Wald zu. Die sanften Hügel hatten sie längst hinter sich gelassen und Temi konnte nicht erkennen, wie groß der Wald war oder was dahinter lag. Selbst im gleißenden Sonnenlicht wirkte er dunkel und bedrohlich. Zumindest bis sie näherkamen. In einer Geschwindigkeit, die Temi den Atem stocken ließ, schossen sie auf die Bäume zu und erst ein paar Sekunden, bevor sie die erste Baumreihe passierten, bemerkte sie einen schmalen Pfad im Wald – der aus der Nähe doch lichter wirkte. Xanthyos preschte mit unverminderter Geschwindigkeit auf den engen, von Moosen und Efeuranken überwucherten Waldweg. Vögel flogen schimpfend auf, wie die Amseln, die sich gestört fühlten, wenn man „ihren“ Garten betrat, ihren Garten zu Hause in Deutschland.
Der Weg wurde offenbar nicht oft benutzt. An einigen Stellen war er zugewachsen und mehrmals duckte sich Xanthyos in letzter Sekunde vor tief herabhängenden Zweigen. Den einen oder anderen bekam Temi dann ab, obwohl der Kentaur fürsorglich den Arm hob und die Zweige aus dem Weg schlug.
„Duck dich!“, rief er ihr zu, als wieder einmal ein kleiner Ast in ihr Gesicht peitschte. Das war leichter gesagt als getan. Es war ohnehin schwierig genug, auf dem hohen Pferderücken das Gleichgewicht zu halten. Ducken konnte sie sich nur, indem sie näher an Xanthyos heranrückte. Sie zögerte kurz, aber als ihr der nächste Zweig an den Hals schlug, schmiegte sich Temi scheu an seinen Körper und schlang ihre Arme um seinen Oberkörper. Sie spürte, wie Xanthyos seine Muskeln kurz anspannte. Seine Sprünge wurden stockender, staccatohafter, als kämpfte er mit sich selbst, ob er diese ungewohnte Berührung zulassen oder sie abschütteln sollte. Doch bald entspannte sich der Kentaur und seine Sprünge wurden wieder länger und rhythmischer.
Der Wald schien kein Ende zu nehmen; Nadel- und Laubbäume wechselten sich ab; hier sprang Xanthyos unvermittelt über einen Bach, dort wurde er langsamer, weil er sich einen Pfad durch ein Dickicht aus Schlingpflanzen und Brennnesseln bahnen musste. Dabei blieb die Landschaft flach; Temi bemerkte keine wesentlichen Anstiege oder Punkte, von denen sie die Umgebung hätte überblicken können. Etwas Gutes hatte der mühsame Ritt durch das Unterholz aber: Die sengende Sonne schimmerte nur hin und wieder durch das dichte Blätterdach. Es musste definitiv Sommer sein, oder sie befand sich in einem Land, in dem schon im Frühling die Temperaturen so hoch waren wie im deutschen Sommer. Vielleicht waren sie in Thessalien, den griechischen Sagen zufolge dem Heimatland der Kentauren.
Temi verlor jedes Zeitgefühl und ihre Armbanduhr funktionierte in dieser Welt nicht. Irgendwann, Temi schätzte nach einer Stunde oder vielleicht anderthalb, lichtete sich urplötzlich der Wald. Ein paar Hügel und eine Wiese mit hohen Gräsern breiteten sich vor ihnen aus. Und dort, nicht weit von ihnen entfernt, ragte eine steinerne Stadtmauer in die Höhe, nur überragt von einer Veste in der Stadt.
Xanthyos hielt abrupt an und erlaubte ihr, die Szenerie zu erfassen. Kleine Gestalten sprangen im Schatten der Mauer umher und jagten einander nach, über die sonnengeflutete Wiese bis zu einem einsamen Baum auf halbem Weg zwischen Mauer und Waldrand, und zurück. Temi sog hörbar Luft ein: Es waren Kinder – spielende Kentaurenkinder! Sie hatte sich noch nie Kentaurenkinder vorgestellt. Ihr Herz zerschmolz bei dem Anblick. Doch sie hatte keine Zeit, diesen Wesen mit den langen staksigen Beinen zuzusehen, denn ein klarer Trompetenton erscholl aus der Stadt. Die Soldaten auf den Stadtmauern waren auf sie aufmerksam geworden. Die Kentaurenkinder erstarrten in ihren Bewegungen, mit weit gespreizten Beinen, wie Fohlen, die sich verjagt hatten. Sie warfen wild den Kopf in alle Richtungen, um die Gefahr ausfindig zu machen, vor der die Trompete gewarnt hatte. Aus dem offenen Tor schossen mehrere Krieger heraus und galoppierten auf Xanthyos zu. Sie trugen keine massigen Eisenrüstungen, sondern Lederharnische und Helme mit wild flatternden Helmbüschen aus Pferdehaar – oder vielleicht ihrem eigenen Haar. Ein Ruck ging durch Xanthyos’ Körper, als er aus dem Stand losgaloppierte. Eins der Kinder zeigte auf sie und mit einem Aufschrei stoben plötzlich alle auseinander und in Richtung Stadttor.
Temi richtete ihre Aufmerksamkeit jetzt ganz auf die acht Krieger, die ihre Schwerter gezogen hatten und fast gleichzeitig mit ihnen den einsamen Baum erreichen würden. Als hätte er ihre Gedanken erraten, wurde Xanthyos langsamer.
„Xanthyos!“, stieß eine der Wachen hervor, als sie Temi und den Schwarzhaarigen erreichten und ein, zwei Meter von ihnen entfernt zum Halt kamen.
„Das bin ich“, gab Xanthyos überheblich zurück. Er legte eine Hand auf Temis Arm – eine Geste, die den anderen Pferdemenschen nicht verborgen blieb. Das Gesicht des Kommandanten der Stadtwache verhärtete sich noch mehr. Temi ahnte wieso: Wenn sie in der Stadt in Sicherheit sein sollte, wie er behauptet hatte, dann erzwang Xanthyos sich freien Eintritt in die Stadt, indem er sie „in der Hand“ hatte. Aber seltsamerweise störte es sie nicht einmal, dass er sie als Pfand benutzte. Der schwarzhaarige Kentaur war ihr auf seltsame Art sympathisch, obwohl seine Krieger Menschen hassten. Wieso die Stadtwachen ihn gefangen nehmen wollten, verstand sie immer noch nicht. Sie musste sich jetzt einfach darauf verlassen, dass die „Menschenfreunde“, wie Xanthyos sie genannt hatte, Temi nicht in Gefahr bringen wollten – und deshalb Xanthyos nicht zu nah kamen.
Читать дальше