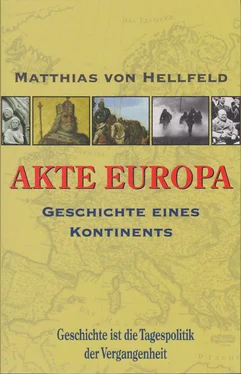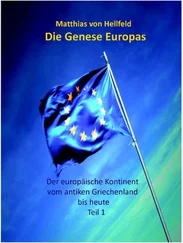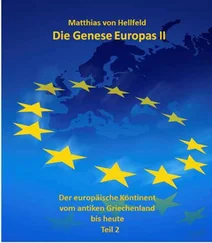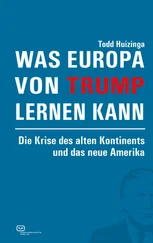Die Straßburger Eide sind logische Konsequenz der politischen Umstände jener Jahre. Keiner der Nachfolger Karls des Großen hat das Format, ein derart großes Reich zu regieren. Die Erhaltung des Frankenreiches als eine politische und ökonomische Einheit, wie zur Zeit des großen Karl, stellt für seinen Sohn und vor allem für seine Enkel keinen erstrebenswerten Zustand dar. Sie sind eher an der eigenen Macht interessiert und sind - so betrachtet - Kinder ihrer Zeit. Die Erhaltung der fränkischen Einheit hätte vermutlich alsbald gezeigt, dass die bei Karl dem Großen noch integrierten Einzelinteressen der unterworfenen Stämme sehr schnell wieder an die Oberfläche gekommen und nach Eigenständigkeit gestrebt hätten. Die rasche Herausbildung unterschiedlicher Sprachen und der stabile Fortbestand der östlichen Herzogtümer (Sachsen, Thüringen, Kärnten, Bayern, Schwaben und Franken), die sich zum Teil in ihren damaligen Stammesgrenzen bis heute erhalten haben, sprechen ebenfalls gegen ein Gesamtreich.
In den folgenden Jahren jedenfalls werden Verträge geschlossen, die die Aufteilung Europas besiegeln und dem Kontinent ein bis heute erkennbares Gesicht geben. Im Vertrag von Verdun 843 erhält Ludwig der Deutsche das ostfränkische Reich, das an seiner westlichen Seite ungefähr durch den Lauf des Rheins, im Süden entlang einer Linie von Genf nach Chur und im Osten bei Regensburg, Magdeburg und Hamburg begrenzt ist. Die Mitte Europas wird Lothar I. zugeschlagen und reicht von Friesland über Lothringen, Burgund und die Lombardei nach Italien. Der Westen schließlich unter Karl dem Kahlen wird das westfränkische Reich, das in seinen Grenzen im Wesentlichen dem heutigen Frankreich entspricht. Aber dabei bleibt es nicht lange. 870 im Vertrag von Meersen wird der mittlere Teil, also die heutigen Benelux-Staaten, aufgelöst und in fast gleichen Teilen dem ost- bzw. westfränkischen Reich zugeschlagen.
Für einen kurzen Moment wird das Reich Karl des Großen unter der Regentschaft eines weiteren Karls, der wegen seiner Leibesfülle mit dem Beinamen „der Dicke“ prämiert wird, noch einmal auferstehen. Als sein Vater Ludwig der Deutsche 876 stirbt, folgt er ihm als König im Ostteil des Frankenreiches. Er beteiligt sich an der Unterwerfung mittelitalienischer Provinzfürsten, die mit Unterstützung der Sarazenen Papst Johannes VIII. an den Kragen wollen. Dieser revanchiert sich prompt mit der Kaiserkrone für den Verteidiger des „patrimonium petri“. Über Erbschaften und andere glückliche Umstände bekommt Karl III., der Dicke, ein paar Jahre später auch noch die Königswürde des westfränkischen Teils. Weil der dicke Karl an der Bekämpfung der Normannen scheitert, die unbarmherzig den Flussläufen folgend ins Landesinnere vorstoßen, brandschatzen und plündern, muss er 887 abdanken. Er wird seines Lebens nicht mehr froh und stirbt bald darauf. Die Todesursache ist allerdings umstritten. Während die einen auf Grund seiner Epilepsie von einem natürlichen Tod sprechen, halten es andere für einen glatten Mord. Einig ist man sich allein im Datum: 13. Januar 888.
Aus der Feder des Geschichtsschreibers Regino von Prüm, der die Zeit Karls des Dicken als Zeitgenosse und Schriftgelehrter miterlebt, stammt die rund 10 Jahre nach dem Tod des korpulenten Kaisers verfasste „Chronica“, eine Schriftensammlung, die sich vor allem mit der Chronologie und der Geschichte der fränkischen Herrscher beschäftigt. Sein Urteil:
„Nach dem Tod des Kaisers löste sich der feste Verband der Reiche, die ihm untertan waren; sie warteten nicht auf den ihnen von der Natur bestimmten Herrn, sondern jedes erkor sich aus sich selbst heraus einen König. Das führte zu schweren Kriegswirren (…) weil eben ihre gleiche edle Abstammung, Würde und Macht die Zwietracht mehrte und keiner so über alle anderen hervorragte, dass diese sich ihm freiwillig unterworfen hätten. Denn zahlreiche zur Herrschaft geeignete Fürsten hätte das Frankenreich geboren, wenn ihnen nicht das Schicksal zu gegenseitigem Wettstreit und Verderben die Waffe in die Hand gedrückt hätte.“
Reginos Analyse ist nicht viel hinzuzufügen, er hat das Problem und den Weg erkannt, den die Ostfranken am Beginn des 10. Jahrhunderts einschlagen werden. Das Ende der Herrschaft des dicken Karls, der das Reich seines großen Namensvetters auf Grund dynastischer Zufälle noch einmal zusammenbringt, stellt eine Zäsur dar. Denn von nun an entwickeln sich die Reichsteile zu selbständigen Gebilden, aus denen später jene Nationen hervorgehen, die heute noch den europäischen Kontinent besiedeln. Der westfränkische Teil – heute Frankreich – hat kaum noch geographische Veränderungen erfahren, die Grenzen verschieben sich im Nordosten und Südosten des Landes nur noch um einige Kilometer. Die Mitte des Kontinents, wo wir heute Luxemburg, Belgien und Holland finden, gehört noch für lange Zeit zu den beiden anderen fränkischen Ländern im Westen und Osten Europas. Das ostfränkische Reich wird in der Folgezeit von Kaisern aus unterschiedlichen Herzogtümern regiert und nimmt– im Gegensatz zum westfränkischen – alsbald die Gestalt eines geopolitischen Flickenteppichs an. Im Osten des alten Karlsreiches sind die Bestrebungen der Stämme und Herzogtümer nach Eigenständigkeit viel deutlicher zu verspüren als im Westen. Der „deutsche“ Kaiser, wie der ostfränkische Kaiser später heißt, herrscht nicht nur über unterschiedliche deutsche Stämme und Völker sondern eben auch über Österreicher, Italiener, Niederländer, Belgier, Luxemburger, Böhmen und Tschechen. Und das wird in den folgenden Jahrhunderten den Weg der „Deutschen“ bestimmen.
In Frankreich und Italien werden nach dem Tod Karls III. erstmals nicht-karolingische Könige gewählt, in Burgund entstehen zwei weitgehend eigenständige Teilreiche mit jeweils anderen Dynastien. Unter Odo, einem Grafen aus Paris, der bis 898 auf dem westfränkischen Königsstuhl sitzt, gibt es auch im Westen des alten Frankenreiches mächtige Provinzfürsten, die einer zentralen Macht entgegen stehen: In Aquitanien, in Katalonien, in der Bretagne oder in Flandern. Die politische Ordnung nach den Karolingern ist in „Frankreich“ nicht einfacher als in „Deutschland“. Hier wie dort streitet die zentrale Macht mit den nach Autonomie und eigener Herrschaft strebenden Provinzmächten. Einzig bei äußeren Gefahren, wie sie etwa die Einfälle der Normannen oder Ungarn darstellen, stehen sie zusammen – darin unterscheiden sich die beiden Nachbarn nicht.
Im Westen des alten Karlsreiches kommt es genau wie im Osten zu unangenehmen Auseinandersetzungen zwischen streitlustigen Familienmitgliedern, die in jeweils wechselnden Koalitionen gegeneinander kämpfen. 987 stirbt mit Ludwig V. der letzte karolingische König. Das Ende der Kämpfe zwischen dem König und den Herzögen wird durch die anschließende Wahl von Hugo Capet eingeläutet. Hugo Capet ist der erste in einer langen Reihe von Kapetingern auf dem französischen Thron. Bis 1328 wird diese Familie den jeweiligen König stellen und so verhindern, dass ständige Dynastiewechsel und von Intrigen begleitete Königswahlen die zentrale Macht schwächen. Der Weg, den Frankreich von nun an gehen wird, ist vorgezeichnet.
Der wohl unabwendbare Zerfall des fränkischen Großreiches ist eine Wegmarke der europäischen Geschichte. Aber was wäre geschehen, wenn die fränkische Einheit gehalten und den Wirren, die da noch kommen sollten, standgehalten hätte? Würden die Europäer dann eine gemeinsame Sprache sprechen? Wären die Kriege, die zwischen dem 10. und 21. Jahrhundert die Mitte des Kontinents mehrfach verwüstet haben, den Menschen erspart geblieben? Gäbe es dann schon lange eine „Europäische Union“, wie sie jetzt entstanden ist? Unabhängig von derartigen Spekulationen beginnt für die Deutschen mit der Teilung des fränkischen Reiches eine wechselvolle und selten glückliche Geschichte. Die deutschen Stämme und Herzöge machen es den jeweiligen Kaisern nahezu unmöglich, eine „Einheit der Deutschen“ herzustellen und zu bewahren. Ganz im Gegenteil: Die partikularen Interessen der Territorialherren stehen den Belangen des „deutschen Reiches“ fast immer diametral entgegen. Mitunter sind die Kaiser Sklaven ihrer Untertanen, weil sie von deren Stimmen bei der Wahl zum Kaiser abhängig sind. Nicht selten wird die Teilnahme an einem Feldzug mit Zugeständnissen an die Großmachtsphantasien irgendwelcher Provinzfürsten erkauft. Das deutsche Reich wird von keiner zentralen Stelle regiert, ein Gemeinschaftsgefühl durch die Zugehörigkeit zum Reich entwickelt sich unter den Bewohnern nicht.
Читать дальше