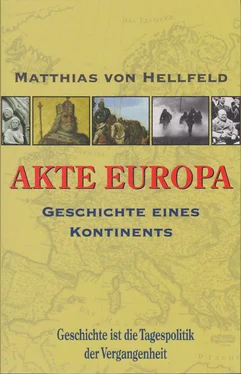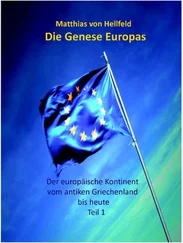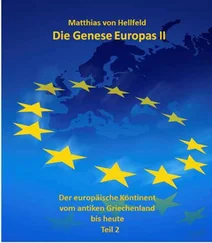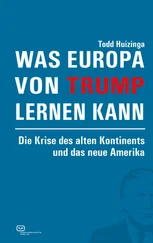Zerfall und Aufteilung des Frankenreiches
829 - 888
… die Ludwig der Fromme im Jahr 829 wohl nicht im Auge hat, als er einen vierten Sohn, namens Karl, aus seiner zweiten Ehe mit Judith, ins Spiel bringt und das Thronfolgegesetz des Jahres 817 zu Gunsten des damals Sechsjährigen ändert. In einer folgenschweren Entscheidung bekommt sein vierter Sohn Karl, der zur besseren Unterscheidung schlicht „der Kahle“ heißt, das schweizerisch-italienische Alamannien und Rätien, sowie das Elsass und einen Teil Burgunds. Diese Neuordnung der Machtverhältnisse geht natürlich zu Lasten der wenig erfreuten Stiefbrüder Karls des Kahlen. Außerdem entzieht Ludwig der Fromme seinem mitregierenden Sohn Lothar I. am gleichen Tag den Anspruch auf den Kaiserthron nach seinem eigenen Ableben. Vieles spricht dafür, dass hinter dieser Entscheidung der Machthunger Judiths, der Tochter des schwäbischen Grafen Welf, steht. Überhaupt sorgt Judith, der besondere Schönheit nachgesagt wird, in ihrer 25jährigen Ehe mit Ludwig dem Frommen für jede Menge Ärger und Zwistigkeiten, die zeitweise sogar zu ihrer Verbannung vom kaiserlichen Hofe führen. Wegen der unerwünschten Konkurrenz durch Karl den Kahlen erheben nun die Kinder aus erster Ehe die frevelnde Hand gegen den eigenen Vater. Sie inszenieren für die nächsten Jahre ein europaweites Macht- und Intrigenspektakel in unterschiedlichsten Konstellationen. Mal agieren sie gemeinsam gegen den Kaiser, ein anderes Mal bekämpfen sie sich gegenseitig.
Anfang des Jahres 830 beschließt Ludwig der Fromme eine kriegerische Eroberungs-Expedition in die Bretagne, dem einzigen Zipfel Kontinentaleuropas, der nicht zum Frankenreich gehört – trotz eines heftigen Anfalls von Gicht im kaiserlichen Fuße, wie die fränkischen „Reichsannalen“ dieses Jahres mitteilen. Aber die Feldzugsidee des Kaisers trifft auf wenig Verständnis bei seinen Vasallen. Diese Verstimmung nutzen einige Abtrünnige dazu, Lothar I. und Pippin I., zu einem Aufruhr gegen den Vater anzustiften. Das geschieht dann auch mit dem Ergebnis, dass Judith ins Kloster geschickt und Ludwig der Fromme von seinen Söhnen entmachtet werden. Aber so leicht ist der fromme Ludwig nicht vom Thron zu stürzen. Er gewinnt die Hoheit über das kaiserliche Zepter zurück und hält einige Reichstage ab, auf denen der Aufstand zwar aufgeklärt, aber nicht bestraft wird. Ludwig ist eben ein frommer und offensichtlich auch nachsichtiger Vater. Das nützt ihm in der Folgezeit aber wenig, denn schon drei Jahre später – 833 – empören sich die Herren Söhne ein weiteres Mal.
Eine nicht unerhebliche Rolle bei dieser Auseinandersetzung um die Macht im Reich spielt Papst Gregor IV., der von Lothar I. zum Schiedsrichter im Familienstreit berufen worden ist. Der heilige Vater macht sich auf den Weg, um auf die Einhaltung des fränkischen Thronfolgerechts von 817 zu drängen, nach der sein Auftragsgeber Lothar I. zum Nachfolger seines Vaters bestimmt werden muss. Gregor IV. lässt sich vom lebhaften Protest einiger Bischöfe nicht abhalten und beginnt mit Ludwig dem Frommen zu verhandeln. Während es dem Papst allmählich gelingt, das Vertrauen des Kaisers zu gewinnen, ergreifen die kaiserlichen Söhne auf dem „Lügenfeld“ bei Colmar die Initiative. Es beginnt eine Schlacht zwischen den Heerscharen des Kaisers und denen seiner Kinder, in deren Verlauf aber weniger das Schwert die entscheidende Rolle spielt, sondern vielmehr die angeblich „lügnerischen“ Überredungskünste der Kinder.
So dauert es nicht lange, bis das kaiserliche Heer sich überzeugen lässt und zu den aufständischen Söhnen überläuft. Der Kaiser gerät daraufhin in Gefangenschaft seiner Kinder und die Mission des Papstes endet in einem grandiosen Fehlschlag. Ludwig der Fromme wird obendrein durch ein erzwungenes Sündenbekenntnis öffentlich gedemütigt. Judith tritt unmittelbar nach den Ereignissen den Gang ins italienische Exil an, während Lothar I. die Entsorgung seines Vaters übernimmt. Er steckt ihn dorthin, wo er nach Meinung vieler ohnehin hingehört: Ins Kloster des heiligen Medard bei Soissons in der Nähe von Reims, wo der fromme Ludwig bald darauf trübsinnig wird. Der Familienzwist, den die Enkel Karls des Großen um die Herrschaft im Frankenreich angezettelt haben, nimmt ein Jahr darauf, 834, eine neuerliche Wendung. Die beiden jüngeren Söhne aus der ersten Ehe erheben sich nun gegen ihren Bruder Lothar I. und setzten den gemeinsamen Vater wieder auf den Thron, den der eigentlich schon entmachtete Ludwig der Fromme bis zu seinem Tod Ende Juni 840 auch behält.
Unter dem Einfluss seiner Frau Judith wird Ludwig der Fromme vom Verfechter der Reichseinheit zum Vorkämpfer der Reichsteilung. Judith ist die Urahnin des fränkischen Adelsgeschlechts der Welfen, aus deren heute lebender Generation uns Prinz Ernst-August von Hannover, Ehemann der Prinzessin Caroline von Monaco, eindrücklich bekannt ist. Seine Ahnin Judith jedenfalls muss sich den Vorwurf gefallen lassen, die Reichseinheit ihres Schwiegervaters Karl aufs Spiel gesetzt zu haben, um ihrem gleichnamigen, aber kahlen Sohn ein lohnenswertes Stück vom Kuchen abzuschneiden. In letzter Konsequenz führt das zur Spaltung des Frankenreiches in einen östlichen, einen mittleren und einen westlichen Teil und somit zur Begründung eines „französischen“ und eines „deutschen“ Staatswesens. Ein Jahr nach dem Ableben des Kaisers tobt unter den Karolingern noch immer heftiger Streit um die Macht im Reich. Lothar I. akzeptiert die von seinem Vater verfügte Dreiteilung des Reiches nicht und gibt sich mit dem ihm zugewiesenen Mittelreich „Lotharingen“ nicht zufrieden. Er beansprucht die Oberhoheit über das gesamte Frankenreich und ruft damit den Zorn seiner Brüder hervor.
Die Aufteilung des Frankenreichs
Den Bürgern Straßburgs ist es in diesem eisigen 14. Februar 842 bange ums Herz als sie aus zwei Richtungen schwer bewaffnete Heere auf ihre schöne Stadt zukommen sehen. Das eine Heer wird angeführt von dem 37-jährigen König Ludwig. Jener Ludwig, der im Nachhinein „der Deutsche“ genannt wird, herrscht über den östlichen Teil des Frankenreichs. Das andere Heer steht unter dem Kommando seines erst 18-jährigen Stiefbruders Karl II., der „der Kahle“ genannt wird. Karl der Kahle ist Judiths Sohn und König von Westfranken. Die beiden Heere treffen sich auf einem Platz im Zentrum der Stadt. Zur Überraschung der Straßburger Bürger aber beginnt keine Schlacht sondern eine erstaunliche Zeremonie. Etwas langatmig und umständlich erklärt erst Ludwig den anwesenden Heerscharen, dass sein Bruder Lothar I. für das hohe Amt des Kaisers gänzlich ungeeignet sei. Seine angeblich unbezähmbare Streitsucht treibe die Teile des großen Frankenreiches auseinander und dieser Zustand sei nicht hinnehmbar. Deshalb wolle er hier und jetzt mit seinem Stiefbruder einen Eid ablegen, der beide untrennbar miteinander gegen das gemeinsame Bruderherz Lothar I. verbindet. Ludwig der Deutsche verwendet dabei „romana lingua“, aus der sich später die französische Sprache entwickelt. Karl II. schließt sich in der „teudisca lingua“, der Grundlage der deutschen Sprache, an. Beide leisten also in dem Dialekt des jeweils anderen den so genannten Straßburger Eid. Diesem Eid schließen sich die beiden Heere an, ohne den jeweils anderen Dialekt zu verstehen. Ein anwesender Geschichtsschreiber notiert, dass dies „der Eid der Völker“ gewesen sei. Und tatsächlich: Dieser 14. Februar 842 kann als die Geburtsstunde Deutschlands und Frankreichs gelten. Aus den beiden Teilen eines Reiches (von Karl dem Großen) werden im Laufe der nächsten Jahrhunderte die beiden Bruderstaaten Deutschland und Frankreich. Die heute so oft beschworene deutsch – französische Partnerschaft, die als Motor für die europäische Entwicklung unverzichtbar sei, hat ihre Wurzeln im frühen 9. Jahrhundert, als aus einem Reich zwei Teilreiche werden, die sich im Laufe der kommenden Jahrhunderte eigenständig entwickeln.
Читать дальше