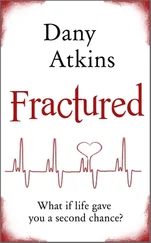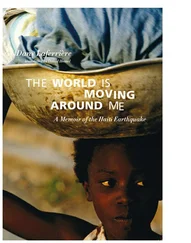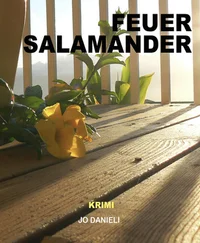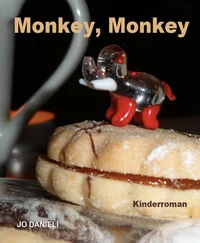Unfassbar fern klettern auch in den Momenten der schwellenden Nostalgie die Ölfruchtpflücker auf Palmen, laufen halbnackte Kinder der Steppe und des Waldes vielleicht schreiend und winkend an ein paar grinsende »Wazungu« (Suaheli: weiße Fremde) heran, die auf schmutzbedeckten Gefährten durch winzige Hüttendörfer im Regenwald holpern. Millionen frischgeschlagener Bananenbüschel liegen neben den Hütten, frei zum Feilschen um lächerliche Summen für alle, die hungrig vorüberkommen. Und graue Schwaden, die am flachen, verschwimmenden Horizont über den hitzeflirrenden Wüstenboden treiben, die selbst den Skorpionen und Wüstenfüchsen einen besorgten Blick wert sind und die menschliche Wüstenbewohner verharren und sinnend Ausschau halten lassen, kündigen einen Sandsturm an ...
Grausam für jene Verliebte, mitansehen zu müssen, wie heute noch (oder erst recht) das »Paradies« mit Blut getränkt wird ...
... und am Ufer eines Dschungelflusses in Kamerun eilen auch zu dieser Stunde tausende braune Weberameisen die saftigen Stengel dunkelgrüner Gewächse auf und ab, ständig in Bewegung ... das Hindernis aus Blattfasern, das ich vor Ewigkeiten um den Stiel einer hohen, saftiggrünen Pflanze gebunden habe, um sie zu necken, ist längst zerfallen.
Nichts hat sich verändert in Afrika durch meinen Besuch. Doch in mir, wie in so vielen, die diesen Kontinent gekostet haben und süchtig geworden sind, hat Afrika eine Saite erklingen lassen, von deren Existenz ich nie erfahren hätte, wäre mir nicht irgendwann zur Winterzeit im Herzen Zentralafrikas aufgegangen, dass dieses Land um mich herum wahrhaftig das Afrika meiner Träume sei. Nach ihm hat es Herrscherhäuser einst verlangt. Es hat Sklaverei und Naturkatastrophen ertragen müssen, den Hochmut der Völker fern seiner Küsten, aber dennoch sucht es kraftvoll durchzuatmen und birgt Wunder, die endlich, endlich ein bisschen unbenannte Sehnsucht im weißen Herzen zu stillen vermögen. Die vielerorts durchaus erfolgreiche Demokratie-Bewegung als Kontrast zu hartnäckigen diktatorischen Systemen nur vage im Kopf, sah ich unterwegs vielfach einfach nur das Fremde, Faszinierende, dachte gar nicht daran, die Menschen der einzelnen Länder als Betroffene gewaltiger Umstürze und Revolutionsmühen anzusehen, sie waren für ich einfach nur – geduldige Gastgeber. Österreich war in Momenten meiner sinnenden Vereinigung mit dem Dunklen, dem Grellen, dem Stillen, Schreienden, Undurchschaubaren und Heißen so fern, dass selbst die Erinnerung an das Daheim der Kinderzeit schwerfiel.
Im Jahr 1855 lenkte der Forscher David Livingstone mit der Entdeckung der Viktoriafälle und seiner Suche nach den Quellen des Nil die Augen der Weltöffentlichkeit auf Leben und Sterben im Schwarzen Kontinent. Seit damals reißt der Zustrom jener, die kommen, die Wiege der Menschheit auf eigene Faust oder bequem gegängelt durch die Tourismusindustrie zu entdecken, nicht mehr ab, war auch die Afrikaberichterstattung über die Jahrhunderte durch unverständige oder von unlauteren Interessen getriebene Besucher zuweilen alles andere als schmeichelhaft für Afrika an sich: »... kulturlos ...«, »... wild ...«, »... grausam ...«, »... ungebildet ...«, »... unzugänglich«. Mittlerweile ist der Rest der Welt reif genug, Afrikas Leistungen als Kontinent uralter Kulturentfaltung anzuerkennen, – afrikanische Geschichte und Kunst »verkaufen sich« gut, schon gar afrikanische Landschaft, allenfalls haben die Ziele der Besucher sich an neue Plätze verschieben lassen müssen, bedingt durch Völkerkriege, deren Ursachen der Besucher zuweilen immer noch zu begreifen verweigert. Beispielsweise sind die ostafrikanischen Tutsi, ehemals ein Hirtenvolk, schon vor gut vierhundert Jahren ins Land der Hutu-Bauern eingezogen und haben mit ihnen jahrhundertelang in guter Partnerschaft gelebt – bis ihnen Kolonialherren gedenk ihrer politischen Organisationsfähigkeit weismachten, Tutsi seien allemal »wertvoller«, als Hutu und sollten eigentlich herrschen ... Der Konflikt, möglicherweise bislang beherrschbar schwelend, wurde bedenkenlos von fremder Hand aufgerührt ... Die Erste Welt beklagt den Völkermord in Ostafrika und anderswo, ihre Fehlleistungen in puncto hilfreiches Einschreiten wie auch ihr ignorantes Missachten des eigenen Mitverschuldens erscheinen durchaus sträflich.
Der amerikanische Journalist Henry Morton Stanley fand den später verschollenen Livingstone unter damals haarsträubenden Abenteuern – aber finden die Afrikareisenden heute den Kontinent so vor, wie es ihrer romantischen Vorstellung entspricht?
Ja, vielleicht geographisch und atmosphärisch – was das tiefste Landesinnere der einzelnen Staaten betrifft. Wer bedenkt, dass das »unterentwickelte« Afrika den Industriestaaten über Jahre Entwicklungshilfe gezahlt hat, indem es seine Rohstoffe verschleuderte und so der Ersten Welt zu Wohlstand verhalf, während es selber darbte, wird vielerart erstaunt sein über die freundliche Gleichmut der Afrikaner, die die Ausrüstung der Wazungu bewundern, freilich auch begehren, aber nicht wirklich ernsthaft. Vieles, was Weiße besitzen oder verkörpern passt nicht einmal annähernd in afrikanische Vorstellungen. Und auch wenn unbedarfte Dorfbewohner die geschenkmäßige Herausgabe von Kameras und derlei teurem Zeug fordern und zu glauben scheinen, alle Weißen seien reich, gleicht das Betrachten und Begehren von Fremdem einem Spiel der provokanten Dreistigkeit, wie das Geschenkeinfordern allgemein im Grunde ist, und selbst wenn sie könnten, würden viele Afrikaner Afrika wohl nie für Europa verlassen. Wie kämen sie auch dazu, sich mir nichts dir nichts in die so fremde, so eigentümlich streng reglementierte Welt der Weißen zu drängen? Wie würden sie sich da fühlen, bedrängt von einer völlig anders »gewachsenen« Mehrheit? Oh ja, Afrikaner können sich köstlich amüsieren über Weiße, egal, welcher Herkunft. Sich wahrhaftig mit ihnen zu befreunden, ist ihnen nicht wirklich ein Bedürfnis.
... und romantisch? Afrika ist kein riesiger Pfuhl aus abwechselnd Urwald und Steppe, in dem es unaufhörlich trommelt und lacht, über dem es abwechselnd glüht und gießt und wo die Kinder nackt mit den Ziegen in der sicheren Umarmung der Dorfgemeinschaften zwischen Lehmhütten spielen. Afrika besteht aus Organen, die nur dem unbedarften Reisenden als einander ähnlich oder nicht einmal unterscheidbar erscheinen. Und begreift der geographisch und politisch immerhin leidlich orientierte Besucher, dass weniger die Grenzbalken die einzelnen »Welten« innerhalb des Kontinents teilen, sondern jahrtausendealte kulturelle (beispielsweise) Abgründe, wird er beunruhigt ob seiner eigenen Abstammung nach Hause fahren und alle sogenannte »Zivilisation« einmal mehr verfluchen.
Weiße neigen immer noch dazu, das Merkmal »schwarze Haut« als Vorwand zu missbrauchen, alle »Afrikaner« als gleich aussehend und seiend zu befinden (was gleich aussieht, kann wohl recht individuell geprägt nicht sein). Was haben aber ein Wolof, ein Tuareg, ein Yoruba, ein Mbuti-Pygmäe, ein Herero, ein Maure und ein Zulu wirklich gemeinsam? Jawohl, – sie leben auf einer Kontinentalscholle, genannt »Afrika«. Aber um einander nur zu grüßen, müssen sie die Hand heben, um einander zu verstehen ... wie auch ein Schwede, ein Spanier, ein Russe, ein Korse und ein Pole.
Doch insgeheim wird Afrika für den Besucher auf ewig eines bleiben: das Land der Schwarzen, parfümiert mit dem Rauchduft der Holzkohlenfeuer. Das mögen ihm die »Afrikaner« verzeihen. Es ist gar nicht böse gemeint. Es ist nur die Unlust der Besucher, Reiseeindrücke und romantische Mitbringsel der Seele in der überschwänglichen Erinnerung nach kulturellen, politischen und soziobiologischen Aspekten zu sortieren. Und sagt er »Schwarzer«, kann er sich darauf verlassen, dass der Wolof-Restaurantbesitzer in Dakar, bei dem er oft zu Reis und scharfem Fisch eingekehrt ist, ihn schlicht »Toubab« nennt, »Weißer«, ungeachtet dessen, woher er stammt und ob er Flämisch spricht oder Portugiesisch.
Читать дальше