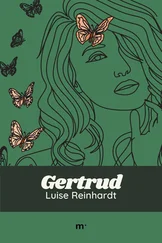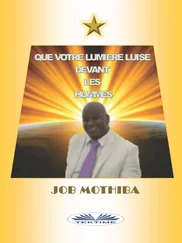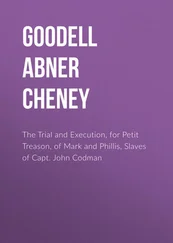Und irgendwann wurde ich getauft, auf den Namen Elisa, die Kurzform von Elisabeth, so hatte nämlich Gustavs Großmutter geheißen, die auch eine Heilerin gewesen war.
Tante Frieda und Onkel Hans kamen zu Besuch, und ihre beiden Söhne Martin, fünf Jahre alt, und Wilfried, sein Brüderchen, drei Monate alt, waren auch dabei. Irgendwie war doch genügend Platz, und meine Tante Frieda hielt mich auf dem Arm und alle bestaunten mich. Aber meine Mutter war nicht da.
So fuhr die kleine Oma bald wieder weg. Denn man hielt es für das Beste, Lenchen und mich zu Marias Eltern nach Juist zu geben. Dort konnte Lenchen mit Onkel Andre, der ein paar Jahre älter als sie war, zur Schule gehen, und die Oma konnte dort gut für mich sorgen!
Warum mich aber so weit weggeben? Ich habe doch gleich nach meiner Geburt gelächelt und mich ganz klein gemacht, damit alles leichter geht.
Es war damals nicht üblich, die Kinder im Krankenhaus bei der kranken Mutter zu lassen, nicht einmal ein Baby! Es war damals moderner, das Kind weit weg zu geben, das hatte mit dem medizinischen Fortschritt und der Modernität zu tun!
Es war die schlimmste Trennung, die ich je erlebte hatte, und alle Trennungen in meinem späteren Leben fühlten sich so an wie jene.
Heute weiß ich, dass meine Mutter damals eine schwere Schwangerschaftsdepression hatte, wie so viele Mütter, die jenen Krieg erleben und irgendwie aushalten und durchhalten mussten. Auch heute leiden viele Frauen unter einer Schwangerschaftsdepression. Nur damals wurde das nicht thematisiert. Wer soll denn eine solche haben, wenn nicht jemand wie Maria, die so viele Schmerzen hatte, so sehr krank und deshalb selbst so bedürftig war? Wie sollte sie einen bedürftigen Säugling versorgen können?
Ich war also hier auf der Erde angekommen und mir fehlte die mütterliche Fürsorge und Geborgenheit. Sie fehlt mir übrigens bis zum heutigen Tag! Heute nennt man das „Early-Life-Stress!“
Die Kindheitsschatten der 1950er-Jahre –Verdrängungszeit
Es gibt keinen Weg, nur Schritte ins Ungewisse .
Christiane B. Dinlger
Der Abschied damals war für alle Beteiligten fürchterlich. Für Gustav, der sich so sehr ein Kind gewünscht hatte, für meine Mutter, die ebenfalls ein Kind gewollt hatte, und wenn es um Gustavs Liebe willen war, und für Lenchen, die gern ein Zuhause mit ihren Eltern gehabt hätte.
Jetzt steht wieder ein Abschied an. Es ist ein Abschied für immer, jedenfalls für dieses Leben. Ich war gestern bei Gustav, meinem Vater, dem „besten Vati der Welt“, so hatte ich es als Kind häufig formuliert.
Jetzt sage ich das auch wieder zu ihm, und er lächelt dann und sieht aus wie ein Engel. Er wird immer schmaler und dünner und zerbrechlicher und ist seit einem halben Jahr nicht mehr aufgestanden.
Er hat einen Katheter, weil er etwas mit der Prostata hat, die Ärzte wissen nicht genau, ob es sich dabei um Krebs handelt. Sie hatten ihm vor einem halben Jahr, als die Schmerzen so stark waren, und er nicht mehr aufstehen konnte und wollte, ein morphiumähnliches Medikament gegeben, das erhebliche Nebenwirkungen hatte. Z. B. verspürte er große Übelkeit und aß und trank nichts mehr. Er war am Verhungern und Verdursten.
Als ich ihn mit Danno, meinem Mann, besuchte, bat er uns, ihn zu retten. Es war so schwierig, das zu entscheiden – ob es Sinn machte, dass er ins Krankenhaus kam oder nicht. Ich sorgte für einen Notarzt. Das war vom Heimpersonal gar nicht erwünscht. Gustav bekam eine Infusion. Ich erkundigte mich hartnäckig bei seinem Hausarzt, ob er denn wirklich Krebs hätte und dieses morphiumähnliche Medikament benötige. Da hieß es, dass er kein Karzinom hätte, die Schmerzen kämen von seiner Arthrose.
Und wegen meines eindringlichen Nachfragens wurde dieses Morphiumpflaster endlich abgesetzt und Gustav erholte sich ein wenig. Er aß ein wenig, sprach wieder klar und sein Gebiss passte auch wieder.
Ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand stirbt, ich war noch nie dabei, jedenfalls nicht in diesem Leben. Es sah schon im vergangenen Herbst so aus, als würde er sterben. Die Trauer fing schon an, jedenfalls bei mir, aber auch bei Lenchen. Maria trauerte und weinte und versuchte tapfer, diese Zeit durchzustehen.
Es gelingt ihr bis heute nicht wirklich.
Ich habe mich damit beschäftigt. Ich möchte alles richtig machen! Wir feierten vor zwei Monaten, im Mai, Marias 90. Geburtstag – bei Gustav in seinem Krankenzimmer. Ich habe eine Mappe mit Fotos, Liedtexten und einer Rede zusammengestellt, die die Höhepunkte aus Marias Leben betonte. Diese habe ich dann auch vorgelesen. Und dann haben wir die Lieder, die meine kleine Oma gesungen hat, selbst gesungen.
Wir, das waren Lenchen, ihr Mann Max, Danno, Maria und ich. Auch Gustav hatte mitgesungen. Er hat immer gern gesungen: zu Weihnachten, wenn im Radio Weihnachtlieder zu hören waren, die zweite Stimme. Ich habe das immer bewundert und genossen …
Maria, das Geburtstagskind, die so gebückt vor Trauer, Last und Schmerzen das Zimmer betreten hatte, bekam einen anderen, lichteren Gesichtsausdruck, als sie meine Rede hörte. Gustav war ganz fein angezogen, wie immer in seinem Leben. Er trug ein wunderschönes weißes Hemd und eine Anzughose.
Das muss sehr anstrengend für ihn gewesen sein, sich überhaupt so anzuziehen, er bedurfte zwar der Hilfe, aber immerhin, er sah äußerst würdevoll aus.
Er konnte aber vor Schwäche nicht aufstehen.
Jetzt bekommt Gustav wieder dieses morphiumähnliche Pflaster. Ich fragte den Arzt. Es soll nun doch ein Karzinom sein. Er ist jetzt angeblich schmerzfrei. Er isst nun fast gar nichts mehr und trinkt auch kaum etwas, da dieses Pflaster eine große Übelkeit hervorruft. Er ist nun tatsächlich am Verhungern und am Verdursten.
Gustav hat Ängste und Panikattacken, davon spricht er manchmal. Auch bei ihm kommen alte Traumata hoch, die sich jetzt ihren Weg bahnen.
Es ist wichtig aufzupassen, was geschieht. Ich traue den Schulmedizinern nicht. Ich finde, dass es gar kein Sterbebett gibt, sondern nur ein Lebensbett. Der Abschied von diesem Leben dient dem Leben, diesem und dann vielleicht, wenn man daran glaubt, ebenfalls einem anderen.
Jedenfalls denke ich, dass das Leben nicht künstlich verlängert werden sollte, aber genauso wenig sollte es künstlich verkürzt werden. Genau hier fängt es an, schwierig zu werden. Die Schulmediziner sprechen von Linderung. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr vorsichtig. Ich kann die Sprüche nicht vertragen, die da lauten: „Er ist ja schon 93, da ist das kein Wunder. Ich wünsche ihm, dass er erlöst wird von dem Leiden!“ Diese Erlösungswünsche fühlen sich für mich sehr unbehaglich an! Wer weiß denn wirklich, wann ein Leben nicht mehr lebenswert ist!? Diese Frage mit der entsprechenden Antwort hatten wir doch schon in der deutschen Geschichte! Vielleicht nimmt Gustav Abschied, vielleicht wird er aber auch zu aktiv verabschiedet, und er hat gar keine Chance mehr zu entscheiden. Es ist die göttliche Kraft, die wirken muss, die menschliche darf hier allerdings nicht eingreifen, nur lindernd, so empfinde ich das. Wo hört die Linderung auf und wo fängt die Lebensverkürzung an? Wissen kann ich das nicht, niemand kann es wissen. Aber es ist die Einstellung, zum Leben, zur Energie, die Lebensbejahung, die Energiebejahung, so lange noch ein Atemzug getan wird. Alles andere ist Mord, was Wilhelm Reich in seiner gleichnamigen Schrift als Christusmord bezeichnet, alles das, was unbedingt leben will, was Energie ist, was Freude und Barmherzigkeit ist, wird zerstört, soll zerstört werden, von der Gegenenergie, von der Gegenwahrheit, wie Wilhelm Reich das nennt, die zu jener natürlichen Kraft des Lebens keinen Zugang hat und auch nicht weiß, wie sie einen bekommen kann und sie deshalb zerstören will.
„Gesundes, gutes Leben ist dagegen in der Lage, Bäume schneller wachsen zu lassen, und es kann aus Fischen Vögel und aus Affen Menschen machen. Genau das ist die Tragödie des kranken und das große Glück des gesunden Lebens. Das kranke Leben weiß dies und weidet sich deshalb daran, das gesunde Leben zu töten und zu verfolgen, wo es nur kann.“ (W. Reich aus seinem Buch „Christusmord“)
Читать дальше