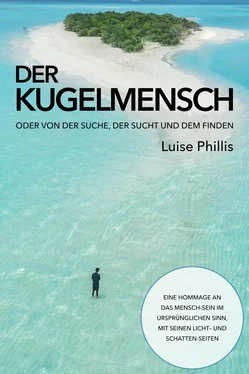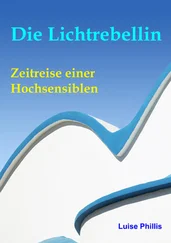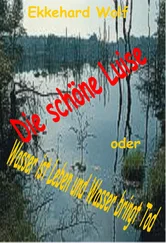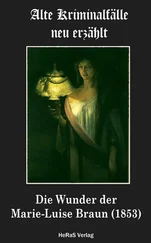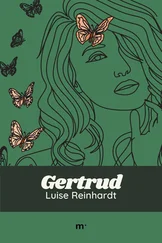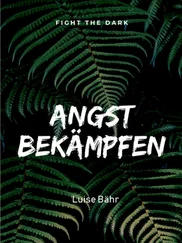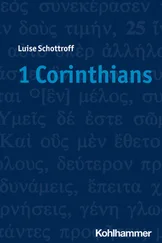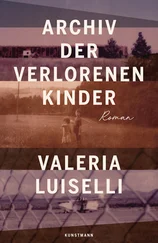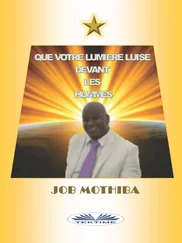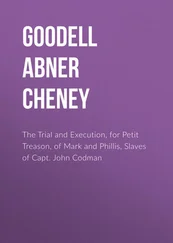Diese Verirrung hat es immer gegeben, die Prostitution ist ja auch „das älteste Gewerbe“ der Welt. Dennoch gibt es Gründe für diesen Missbrauch. Der Urgrund ist die „Vertreibung aus dem Paradies“, die Sehnsucht des Menschen nach dem, wo er hergekommen ist, der Verlust der Urheimat, der Urliebe.
Leider hat sich in unserer heutigen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts die Prostitution noch mehr ausgebreitet als je zuvor. Hierbei ist die „normale“ Prostitution jedoch von der Zwangsprostitution, die meistens mit Kinderprostitution verbunden ist, zu unterscheiden. Aber nicht nur bei der Zwangsprostitution wird deutlich, dass es sich um schwierige Kindheiten handelt, die all jene Menschen, die an der Prostitution beteiligt sind, in der Regel erleiden mussten. Ein Zuwendungsmangel vom Vater und eine nicht stattgefundene Abnabelung des Jungen von der Mutter können ihn auf die Laufbahn eines Zuhälters bringen und sexueller Missbrauch in der Kindheit oder ein Zuwendungsmangel können die Mädchen zu Prostituierten werden lassen. Armut ist ein weiterer Grund für die weltweite Ausbreitung der Prostitution, vor allem der Zwangsprostitution.
Was können wir dagegen tun? --- Wir haben zunächst die Möglichkeit bei uns selbst anzufangen, uns selbst anzusehen und zu stabilisieren, damit wir nicht auf der Stufe der süchtig Suchenden stehen bleiben müssen.
Warum die Prostitution eine so weit verbreitete Verirrung ist, zeigt uns die Ursehnsucht nach Zuwendung, nach Urheimat.
Das Angefasst-Werden, die Sexualität, selbst wenn sie käuflich erworben werden kann, schafft zumindest die Illusion von Einssein. Das Gegenteil ist zwar der Fall, da das Fehlen der Liebe ein Gefühl von Angekommensein verhindert. Stattdessen muss der Mensch immer weiter suchen und wird ein süchtig Suchender, was er dann auch wiederum kompensieren muss, z. B. durch Alkohol, Drogen, Esssucht, Arbeitsucht usw.
Warum bietet nun das andere Lebensmodell keine Erfüllung, nämlich in Askese zu leben und Gott zu dienen, d. h. nur der geistig-geistlichen Kraft entsprechend zu leben, z. B. in einem Kloster.
Die Protagonistin im Märchen erfährt hier auch keine Liebe, da die Zeremonien, die Kargheit des Alltags keine Freude bringen. Diese Art von Einseitigkeit ist genauso unbefriedigend zu leben wie die des Sinnesrausches. Auch hier ist Glück nicht zu erspüren und zu erleben. Die nicht-gelebte sexuelle Energie als Urkraft wird zwar in spirituelle Energie „umgelenkt“, aber das gelingt nicht immer, häufig nur selten, und da bleibt ein Gefühl des Unbefriedigt-Seins und des Mangels, der auch wieder zum Suchen, sogar zur Sucht führen kann. Besonders Frauen haben auch heute noch die Spaltung von Sexualität und Religion zu ertragen, besonders in den islamischen Gesellschaften und selbst in der westlich-christlichen Welt, wo die katholische Kirche keine Verhütungsmittel erlaubt, da der Geschlechtsakt ausschließlich der Fortpflanzung diene. Der 2005 verstorbene Papst Paul II. verurteilte Verhütung als Kindsmord. Wenn wir uns das verdeutlichen, wird es verständlich, dass die Menschen eine immer größere Trennung zwischen den Bereichen der Spiritualität und der Sexualität vollziehen. Leider wird Religiosität und kirchliches Dogma in der Regel häufig identisch gesehen. Um sich von dem Druck dieser Dogmen, Reglementierungen und Normen zu befreien, lässt der Mensch schließlich die Religion ganz aus dem Spiel und meint nun frei von lästigen Einschränkungen zu sein. Jedoch schafft diese Befreiung keine wirkliche Freiheit, da ja ein wichtiges Element des menschlichen Daseins fehlt, die geistig/geistliche Dimension.
Als Handlungsorientierung wird die Dualität von Körper und Geist auch in die säkularisierte Welt übernommen.
Frauen erfahren und erleiden auch hier die Spaltung, die Trennung von Körperlichkeit und geistigem Potential. Diese Trennung, die eine doppelte Moral darstellt und neurotisches Verhalten zur Folge hat, spaltet den Menschen ab von seinem Ursprung und verhindert eine Heilung, eine Ganzwerdung.
In der Literatur und in Filmen wird uns dieses Menschenbild, dieses Frauenbild immer wieder nahe gebracht.
Der griechische Spielfilm „Sonntags nie“ (1960) von Jule Dassin zeigt den ungelebten Konflikt einer Hure auf, deren Dasein die „echte“ griechische Lebensweise verkörpern soll. Dieser Film war viele Jahre verboten und auf dem Markt verschwunden, und zwar zu der Zeit, als die Hauptdarstellerin Melina Mercouri Kulturministerin in Griechenland wurde.
Die Protagonistin des Films ist Illia, eine attraktive und begehrenswerte Frau, die am Hafen von Piräus lebt und allen Männern als Prostituierte den Kopf verdreht. Als eines Tages ein amerikanischer Tourist, Homer Thrace, in den Hafen kommt und einen Annäherungsversuch wagt, ist Illia sehr irritiert, da er nicht an ihrem Körper und ihrer Sexualität interessiert ist, sondern an Griechenlands Kultur. Als Hobbyphilosoph will Homer Thrace Illia, die er als „gefallenen Engel“ sieht, wieder zu einer griechischen Göttin emporheben.
Doch Illia lässt sich trotz ihres Versuches sich kulturell zu bilden, von ihrer Art zu leben, nicht abbringen. Sie will eben so leben, wie sie lebt, und verbindet dies mit Freiheit und Lebenslust und schließlich sieht der Amerikaner ein, dass sie nur so glücklich sein kann, wie sie immer schon gelebt hat, und er verlässt schließlich Griechenland.
Bemerkenswert ist bei diesem Film, die Rolle der Protagonistin Illia, die als Sympathieträgerin Freiheit und Individualität verkörpern und das freie, nicht-amerikanisierte Griechenland repräsentieren soll. Allerdings „repräsentiert“ sie dies alles in einer einseitig festgelegten tragischen Frauenrolle, nämlich die einer unterdrückten Aphrodite, und zwar als Prostituierte und nicht z. B. als freie Schriftstellerin, Sängerin oder Malerin, was der erlösten, eigentlichen Charakterart der Aphrodite entspräche. Vielmehr wird ihr „freiheitliches“ Dasein, das als Prostituierte niemals wirklich frei sein kann, auf die käufliche Liebe reduziert und gleichzeitig als Individualität und Freiheit dargestellt. Als Prostituierte zu leben ist niemals frei, es entspringt immer einer mangelnden Selbstliebe, die in der Regel die Folge einer schwierigen Kindheit ist.
Es handelt sich hier einerseits um einen großartigen Film, der tatsächlich einen Einblick in das noch touristisch unverdorbene Griechenland bietet, jedoch ist die Verknüpfung von Lebenslust, Freiheit und Individualität mit Prostitution nicht unproblematisch hinsichtlich der Vermittlung eines integren Frauenbildes.
Dies wird noch deutlicher, wenn wir uns den Inhalt des bekannten Romans „Alexis Sorbas“ von Nikos Kazantzaki, der 1964 von Michael Cacoyannis verfilmt wurde, ansehen.
Der Protagonist Alexis Sorbas ist mit einem englischen Schriftsteller befreundet und repräsentiert genau wie Illia in dem Film „Sonntags nie“ das echte, lebendige, bodenständige Griechenland. Sein Leben ist ein einziger Tanz, denn er tanzt, wenn er glücklich und auch wenn er traurig ist. Er liebt die Frauen und fühlt sich frei in seinem Denken und Handeln.
Er muss sich nicht prostituieren, um Freiheit zu propagieren, vielmehr ist er ein Lebenskünstler, der seinen englischen Freund zum Schreiben inspiriert. Als dieser mit einer attraktiven Witwe eine Liebesnacht verbringt, wird diese von den Dorfbewohnern gesteinigt und stirbt. Alexis Sorbas akzeptiert diesen moralischen Zwangsvollzug, obwohl er als starker Mann und anerkannter Mitbewohner des Dorfes und als Freiheitsliebender dieses Unglück hätte verhindern können und müssen.
Vergleichen wir die beiden Filme miteinander, wird deutlich, dass die Frauenfigur in „Alexis Sorbas“, den Moralvorstellungen des Griechenlands der 1960er Jahre zum Opfer fällt und dass Alexis Sorbas als Mann seine Sexualität frei ausleben kann ohne bestraft oder diskriminiert zu werden. Der männliche Seelenanteil muss der Beschützer des Weiblichen sein, sonst wird er seiner ursprünglichen Aufgabe nicht gerecht. Yin und Yang können nicht willkürlich vertauscht werden, beides muss vorkommen im Lebensganzen, beides an seinem Platz mit seiner Zuständigkeit.
Читать дальше