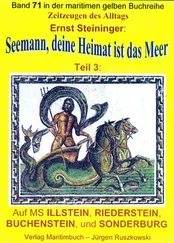Die Nordsee selbst, ich mochte sie nicht besonders. Entweder lag sie bleiern da, und es schien, als wolle sie das Schiff für immer wie ein Stück Treibholz festhalten. Dann wieder peitschten die aus Nordwesten anstürmenden Brecher über das flache Küstengewässer. Wehe dem Schiff, dessen Maschine diesen Kräften nicht standhält. Entweder landet es auf den „Gründen“ (Sandbänken) oder verheddert sich in einem der zahlreichen Wracks jener Schiffe, die von einer der gefürchteten Grundseen verschlungen wurden, wenn sie nicht aufgrund einer Kollision gesunken waren. Der sonst so schweigsame Steuermann wusste gelegentlich – aus seiner Fischdampferzeit – von haarsträubenden Geschichten zu berichten. Allerdings, was nun die Fischerei betrifft – das ist ein Kapitel für sich, das ich jetzt aber nicht aufschlagen will. So viel nur sei gesagt: Selbst mir fiel auf, dass sich die Fischer nicht einen Deut um die SStO (Seewasserstraßenordnung) kümmerten. Auch nicht auf dem „Zwangsweg“, der amtlich vorgeschriebenen Fahrtroute an der deutsch-holländischen Küste. Aber was ging mich die SStO an? Ich war Moses und ein Seppl noch dazu…
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die märchenhaften Nächte auf der sommerlichen Ostsee: Ein weiter, grandioser Silbersee unter einem zartblauen Firmament, durch das zaghaft, aus ganz weiter Ferne, die Sterne glitzerten. Doch diese Idylle war nur von kurzer Dauer. Der Herbst kam früh und mit ihm die kalte, ungemütliche, unfreundliche „Windsbraut“. Die STADERSAND begann wieder zu hoppeln, zu bocken, zu schlingern. Aber, wie sehr sie sich auch bemühte, mich wieder seekrank zu machen, das schaffte sie nicht mehr. Ich war inzwischen so seefest, wie es nur ein alter Seebär sein kann. Nicht einmal die Nordsee – und Nordsee ist Mordsee, wie man weiß – konnte mich zum Kotzen bringen. Was aber nicht heißt, dass mir nicht oft genug zum Kotzen war – aber das lag mehr an dem unmenschlichen Wachdienst und dem alltäglichen Fraß…
Während der Sommermonate – das muss ich gerechtigkeitshalber erwähnen – hatte die mitfahrende Frau des Kapitäns für ein halbwegs anständiges Menü gesorgt. Das eingeschränkte Lob deswegen, weil ich mich noch immer nicht an die norddeutsche Kost gewöhnt hatte: Kein Schnitzel, keine Semmelknödel, keine Dampfnudel; stattdessen: Sauerbraten, grüne Heringe, Königsberger Klopse und zu allem Kartoffeln, Kartoffeln , Kartoffeln… Aber diese relativ fetten Zeiten waren bald wieder vorbei, und dann gab es hauptsächlich nur noch – Bratkartoffel mit Gasölgeschmack, denn Gasöl-Manfred hatte wieder das Ganze in der Kombüse. Zum Glück gab es da ja noch die Bunkerstation in Rendsburg, ich wäre sonst glatt verhungert. Im niederländischen Delfzijl versuchte Meister Lottl, der gute alte Maschinist, mich mit einer Delikatesse bekannt zu machen. Er reichte mir eine Tüte mit frisch abgebrühten kleinen Garnelen, Granat genannt. Leider verschwieg er mir – wohl weniger aus Absicht, sondern eher aus Vergesslichkeit – dass man die Würmchen vor Genuss auspuhlen muss. Empört spukte ich das Zeug aus und wunderte mich wieder einmal mehr über die Eßgewohnheiten dieser Barbaren…
Wir waren also fest in der Holzfahrt. Nur hin und wieder liefen wir auf der Rückfahrt von Belgien auch Bremen an, um für die Spedition Ahlmann Stückgut nach Schweden zu karren. Bei einer dieser Gelegenheiten schickte mich der Alte zum Röntgen. Der Befund war negativ: Mein Kreuz hatte den unfreiwilligen „Absprung“ anscheinend ohne Schaden überstanden. So weit, so gut. Besser noch: Dass ich letztendlich zum Jahresende das Schiff mit heilen Knochen verlassen konnte – ja, dass es mich nicht vorzeitig in die Tiefe mitgerissen hatte…
Aber nein, ich hab nicht die geringste Ahnung, wie mein erstes Schiff geendet ist. Ob auf dem Abwrackplatz oder ob es auf dem Meeresgrunde liegt – was eher anzunehmen ist. Warum? Während meiner Bord-Zeit gab es einige kritische Situationen, in denen in wenigen Minuten von einer unsichtbaren Instanz über „Sein oder Nichtsein“ entschieden wurde. Dabei denke ich nicht einmal an die „Beinahekollisionen“, sondern mir graut nachträglich noch bei dem Gedanken, mit welcher Unbedarftheit die Kümoschipper an die Schiffsstabilität herangingen. Diese A2-Leute (damals kleinstes Kapitänspatent) hatten bestenfalls so etwas wie eine Ahnung von den Kriterien einer Stabilitätskurve. An den Seefahrtschulen wurden sie innerhalb ihrer Ausbildung darüber nicht belehrt. Also schätzten sie den Umfang der Stabilität – so wie die Altvorderen – nach dem „Beingefühl“, das sie beim Rollen des Schiffes verspürten…
Schnittholz ist vom Gewicht her eine vergleichsweise leichte Ladung. Man packte also, nachdem der Laderaum voll war, noch soviel, wie nur möglich, als Decksladung obenauf. Je mehr Raummeter Ladung, desto besser – für den Reeder. Der Schiffsführer hatte abzuwägen, was noch geht und was nicht. Auf keinen Fall ging es, die Deckslast höher wachsen zu lassen, als es die Brückenfenster zuließen; schließlich musste man ja noch darüber hinweg gucken können. Zuletzt musste das Paket dann auch noch seefest verschnürt werden. Dazu brachten wir Drahtstander in losen Buchten seitlich an den Bordwänden an und holten die dann mittels Taljen über die Oberkanten der Decksladung teid. Davor noch wurden die dicht an dicht liegenden Bretter mit so vielen Persenningen abgedeckt, wie wir nur hatten, um das gefährliche Nasswerden des Holzes nach Möglichkeit zu verhindern. Aber natürlich konnte man die Decksladung niemals so komplett abdecken, dass das Wasser, die stürmische See keine ungeschützte Angriffsfläche gefunden hätte. Da waren die Aussparungen für unsere zwei Masten. Der Zugang zu dem unter der Back liegenden Kabelgatt musste frei bleiben. Die Außenseiten der Decksladung wirksam vor Nässe zu schützen, dazu waren wir sowieso nicht in der Lage, weil sich die Speigatts in der Verschanzung schlecht verstopfen ließen…
Ob nun das Schiff nach Beendigung der Ladungsarbeiten sich noch in einem seetüchtigen Zustand befand, das konnte erst nach dem Ablegen geprüft werden. Wenn es bereits nach kurzer Fahrt und noch im ruhigen Hafengewässer einige Grad zur Seite kippte und nicht mehr zurück schwang, ja dann – dann war was faul im Staate… Dann hätte man sofort wieder an die Pier gemusst, um an Ort und Stelle die Ladung teilweise zu löschen. Dass wir manches Mal wie ein kranker Fisch aus dem Hafen schlichen, daran kann ich mich schon erinnern. Dass wir aber einmal umgekehrt wären, nur weil sich bei der ersten Hartruderlage sogleich auch das Schiff zur Seite neigte und in dieser Lage verharrte, das habe ich nicht erlebt. Aber immerhin: Das Pech einer „VASA“, die nach dem „Leinen los“ noch im Hafenbecken mit Mann, Maus und Musketen kenterte – dieses Pech blieb uns erspart. Einmal allerdings, das Schiff war mir in stürmischer See aus dem Ruder gelaufen, stockte mir der Herzschlag. Aus dem finnischen Meerbusen kommend, war ich bemüht – ich war allein auf der Brücke – das überladene, kopflastige Schiff auf Kurs zu halten. Es war eine stockfinstere Nacht. Die von einem heftigen nordwestlichen Wind gepeitschten Wellen klatschten böse gegen unsere Steuerbordseite. Urplötzlich erfasste eine übergroße Welle, die ich in der Finsternis nicht kommen sah, das Schiff vorn an der Steuerbordseite, hob es hoch und drückte es dabei auf die Backbordseite. Einen Augenblick lang schien mir das Schiff in dieser Stellung verharren zu wollen – wie ein Mensch auf einem Bein, der krampfhaft versucht, das Gleichgewicht zu halten. Im nächsten Augenblick kippte es, noch immer in Backbord-Seitenlage, über den Rücken der Welle nach vorn... Gnädigerweise wurden wir von der nächstfolgenden Welle, die krachend über uns hinwegfegte, nicht verschluckt. Wie dem Alten, der wenig später auf der Brücke stand, zumute war, das weiß ich nicht. Mir aber war trotz aller Unbedarftheit klar: Das war knapp! Und ich tat fürderhin die vielen Geschichten, die man sich von verschwundenen oder kieloben treibenden „Holzfrachtern“ erzählte – die Rede ist von der Nord- und Ostsee und nicht vom Bermuda-Dreieck – nicht länger als „Seemannsgarn“ ab. Und seit dem Unglück – wie ich dieses Wort doch hasse, steht es doch in der Regel für menschliches Versagen, für Schlamperei, für unzumutbare Bedingungen, für nicht erfolgte Ausbildung, für Gewinnmaximierung – also seit dem „Unglück“ der „ESTONIA“ weiß ja nun auch der Rest der Welt, dass die Ostsee nicht bloß ein harmloses Planschbecken ist.
Читать дальше