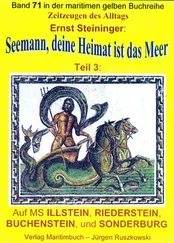Nach dem Löschen der schwer ramponierten Ladung ging es im Ballast nach einem Zellulosewerk bei Gävle. Dort sollten wir Zellulose für Bremen laden. Wiederum in stockfinsterer Nacht passierten wir die Schären, wiederum in nördlicher Richtung. Wiederum zeigte uns der Nordwind, spätestens nachdem wir das Feuerschiff „SVENSKA BJÖRN“ hinter uns gelassen hatten, seine hässliche Fratze. Wiederum erfasste mich sogleich die vermaledeite Seekrankheit, und überdies hatte ich keine der Kälte angemessene Unterhose… Trotz übereinander angezogener Hosen und Pullover fror ich während der Ladungsarbeiten im Hafen jämmerlich. Ich beneidete die Hafenarbeiter um ihre Beweglichkeit, die mit einem gekonnt angewendeten Stauhaken die schweren Zellulosepakete mit scheinbarer Leichtigkeit an ihren Stauplatz beförderten. Ich hingegen stand mir an Deck die Füße in den Bauch – auf des Steuermanns Anordnung und nach meinem Dafürhalten völlig unsinnigerweise. Der Steuermann hingegen, der machte wieder einmal mehr „Zeugwäsche“. Auch meine anderen Kollegen wärmten sich mit Tee mit Rum oder gleich mit einem steifen Grog in der Mannschaftsmesse auf. „Moses“ zu sein, ist – verdammt noch mal! – wirklich kein Honiglecken…
Die „Heimreise“ nach Bremen auch nicht. Die Wellen, die nun meist von achtern oder seitlich anrollten, schoben und hoben und senkten das kaum steuerbare Schiff nach Belieben. Die Ostsee, die für mich bislang ja gar kein richtiges Meer war, eher so was wie ein größerer Ententeich, zahlte mir meine dümmliche Überheblichkeit gründlich heim. Halb über die Reling hängend, würgte und kotzte ich, spuckte gegen den Wind, kämpfte mit dem Steuerrad, das mir bei allzu heftigen Wellenschlägen auf das Ruderblatt immer wieder mal regelrecht aus den Händen gerissen wurde, und versuchte dann, während der Freiwache, in voller Verzweiflung über meine aussichtslose Situation, etwas Schlaf zu finden. Und wenn mir auch zum „Überbordspringen“ war, wenigstens bis Bremen wollte ich noch durchhalten und dann – dann nichts wie weg… Dann aber, spätestens ab Kiel-Holtenau, im Nord-Ostsee-Kanal, regten sich bei mir wieder die Überlebensgeister. Ich interessierte mich wieder für Hannas Kochkünste, und wenn ich auch von der norddeutschen Kost noch immer nicht sehr angetan war, der Hunger trieb es rein… In Bremen angekommen, ging es mir bereits wieder so gut, dass ich – eingedenk der hinterfotzigen Bemerkung meines Stiefvaters: „In vierzehn Dag bist eh wieda do!“ – es doch noch einmal versuchen wollte…
Die STADERSAND, zu diesem Zeitpunkt noch in Charter für die Reederei Ahlmann und von dieser in der Skandinavienfahrt eingesetzt, fuhr also wieder gen Norden. Eine Reihe schwedischer Häfen, von Karlskrona bis Lulea, waren das Ziel der nächsten zwei Wochen. Ich hoffte inbrünstig, dass sich doch um Himmels Willen das Wetter etwas gebessert haben möge. Schließlich hatten wir schon fast April. Kurz gesagt, hatten wir dann auch die meiste Zeit über Aprilwetter… Um das berühmte „eine Haar“ wäre die Reise an ihrem Anfang bereits zu Ende gewesen: In der Elbmündung bei Cuxhaven, Höhe Kugelbake, lief mir das Schiff nach dem Passieren eines „Dickschiffes“ und infolge des Gezeitenstromes plötzlich aus dem Ruder. Selbst zu dritt – der Alte, der Lotse und ich – vermochten wir vorerst nicht, das Steuerrad aus seiner Hart-Backbord-Lage zurückzudrehen. Wie schon gesagt, um das berühmte Haar wären wir dabei von einem nachkommenden großen Frachter, einem Überholer, untergemangelt worden. Sobald wir das Schiff wieder auf Kurs hatten – und die beiden Herren sich beruhigt hatten – durfte ich wieder alleine steuern. Es gab keine Schuldzuweisungen; der Alte wusste nur zu gut, wie schwer sich diese Gurke bei Kopflastigkeit und dann noch im Strom steuern ließ. Das Steuerproblem war demnach auch ein Beladungs- und Stabilitätsproblem – aber davon verstand ich damals selbstredend noch nichts…
Die Fahrt durch die Ostsee bis in den bottnischen Meerbusen verlief – Gottseidank – ohne größere Zwischenfälle. Ich wurde immer noch seekrank, wenn auch nicht mehr so doll wie auf der vorigen Reise. Immer noch war es saukalt, wenn wir auch keine „Eisberührungen“ mehr hatten. Das Ein- bzw. Aufrollen der hart gefrorenen Persenninge, die der Lukenabdichtung dienten; das händische Aufkurbeln der zwei Ladebäume im eisigen Frost; überhaupt alle Arbeiten im Hafen ließen sich – laut Heini und Fiete – nur mit aufwärmendem Getränk bewältigen.
Dieser Meinung waren offensichtlich auch nicht wenige Einheimische, obwohl die anscheinend nicht gerade zur arbeitenden Bevölkerung zählten. Hinter den Hafenschuppen versteckt, lauerten sie auf einen günstigen Moment, um – vom Zoll unbemerkt – ans Schiff zu gelangen und von uns Schnaps zu erbeuten. „Ha du Snaps?“ war die Standardfrage – und meistens hatten wir: pro Nase mindestens eine Flasche Sprit und dazu noch eine Stange Zigaretten. Das brachte pro Flasche bis zu zwanzig Schwedenkronen – bei meiner Heuer von geraden einmal fünfundsechzig Deutschmark eine nicht zu verachtende Nebeneinnahme. Eine Flasche Spirituosen und eine Stange Zigaretten wurden vom örtlichen Zoll für die jeweilige Liegezeit im Hafen in der Regel als offizielles Guthaben genehmigt. Alles, was mehr war, war Konterbande und fiel in die Kompetenz der von uns so gefürchteten „Schwarzen Gang“. Diese, bestehend aus mehreren in schwarzen Overalls steckenden Männern, kam stets urplötzlich und vor allem unangemeldet an Bord und durchsuchte das ganze Schiff, sowohl den privaten als auch den übrigen Bereich, nach Schmuggelware. Auf der STADERSAND lohnte sich solch ein Aufwand fürwahr nicht. Bei uns wurde nur im ganz kleinen Stil geschmuggelt; und nur diejenigen, die den Hansen-Rum oder den Asbach Uralt für sich selbst benötigten, besorgten sich zusätzlich ein, zwei Flaschen Sprit fürs Geschäft. Wo meine Kollegen ihre „heiße Ware“ versteckten, blieb mir lange verborgen. Mein erster Versuch, wenigstens eine Stange Zigaretten – die mir wegen meines Seekrankseins sowieso nicht schmeckten – am Zoll vorbei zu kriegen, schlug prompt fehl. Das Kabelgatt, ganz vorne unter der Back, schien mir der geeignete Ort zu sein, die Zigarettenpackungen einzeln zwischen allerlei Gerätschaften zu verstecken. Als die „schwarzen Männer“, anscheinend ohne fündig geworden zu sein, wieder von Bord waren, gedachte ich frohgemut, meine Zigaretten wieder einzusammeln, um sie postwendend zu verscherbeln. Doch ach, bitter war die Enttäuschung, ich fand nicht eine einzige Packung wieder. Dabei musste ich noch froh sein, dass einer der Zöllner sie bloß so eingesackt hatte und ich somit keine Buße aufgebrummt bekam. Heiko, mein Kammergenosse, meinte schadenfroh: Etwas im Kabelgatt zu verstecken, so doof kann nur ein Neuling sein… Das Warum – und vor allem, wo er denn sein Zeug versteckte, verriet er mir nicht. Um das zu erfahren, bedurfte es erst einer „Begegnung“ mit dem Schmierer Manfred. Manfred war als Maschinenjunge gemustert, hatte ein äußerst unappetitliches Aussehen, seine dreckigen Klamotten waren immerzu verölt, er roch drei Meilen gegen den Wind nach Gasöl. Ich hatte ihn bislang eigentlich nur dann zu sehen bekommen, wenn er auf dem Bootsdeck, gleich hinter der Brücke und direkt am Schornstein mit einer Handpumpe den Tagestank für Gasöl auffüllte. Manfred war stark und groß, hatte ein rundes Pickelgesicht, in das ihm schmutziggelbe Haarsträhnen fielen. Ich brauchte ihn gar nicht zu sehen; wenn ich ihn nur roch, wurde mir gleich noch übler, als es mir meist sowieso schon war. Aber was immer man gegen sein Äußeres vorbringen konnte, vom Gemüt her war er einfach hilfsbereit. Und er war es dann auch, der mir den Tipp gab, mich wegen dieses Problems doch an Meister Lottl, den alten Mann in der Maschine, zu wenden. Meister Lottl, einen spindeldürren, langen Menschen in der gebeugten Haltung eines langjährigen Kellerbewohners, hatte ich bislang nur zu sehen bekommen, wenn er mal kurz zum Luftholen an Deck erschien. Er war mir freundlich gesinnt; und fortan durfte ich meine bescheidene Konterbande ihm anvertrauen. Das geniale, vom Zoll niemals – jedenfalls nicht während meiner Ägide – entdeckte Versteck war das Innere der abgestellten Abgasturbine… Da die schmale Heuer am Monatsende stets durch irgendwelche Vorschüsse in der Regel bereits aufgefressen war, waren die Schmuggelkronen somit das einzig „wirkliche“ Geld, das ich im „Jahr der STADERSAND“ in die Hände bekam…
Читать дальше