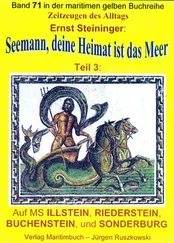In Rendsburg, das am Kanal – auf halbem Weg nach Kiel-Holtenau – liegt, wurde gebunkert. Der Kapitän nutzte den kurzen Aufenthalt, um mich durch das örtliche Seemannsamt ordentlich anmustern zu lassen. Ab dem 9. März 1958 war ich also Decksjunge auf dem Motorschiff STADERSAND, das dem Ziegelwerksbesitzer und Reeder Ch. Meyer gehörte. Das Schiff war vielleicht gerade einmal 60 Meter lang, keine 10 Meter breit, und der Heimathafen war Stade. Geführt wurde es von Kapitän W., der aber auch rein gar nichts Seemännisches an sich hatte. Wiewohl er sicherlich ein anständiger Mensch, ein Familienmensch, war. So oft es nur ging, hatte er seine Frau samt Kleinkind an Bord. Auf der Brücke ging es manchmal zu wie in der guten Stube eines Reihenhauses. Der „Alte“, im gestreiften oder karierten Hemd und in einer blauen Schlaghose, gemütlich im Lotsenstuhl sitzend; derweil „sin Fru“ das Baby in ihren Armen wiegend, gelangweilt durch die Brückenfenster – die allerdings keine Gardinen hatten – in die Gegend sah. So gemütlich ging es aber nicht immer zu, schon gar nicht in den „Iden des März“ 1958.
Kaum, dass wir den Kanal verlassen hatten und uns anschickten, die Kieler Förde zu durchfahren – unser nächster Hafen sollte Malmö sein – begann auch schon wieder die verdammte Schaukelei, und spätestens nach dem Passieren des Marine-Ehrenmales in Laboe war mir bereits wieder zum Kotzen. Als wir dann den Lotsen abgegeben hatten und mit östlichem Kurs der offenen Ostsee zustrebten, gesellte sich zu dem unangenehmen Schaukeln ein noch viel unangenehmeres Stampfen. Ein eiskalter, stetig anschwellender nordöstlicher Wind fegte über den Fehmarnbelt. Der Starkwind entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem richtigen, bösen Wintersturm und blies uns nun, nach der Kursänderung bei Gedser-Odde, voll ins Gesicht. Das Schiffchen stampfte und ruckelte und rollte erbärmlich, und ich? Ich kotzte mir sozusagen die Seele aus dem Leib. Was heißt hier Seele: Ich kotzte Blut… Hanna, der ich leid tat, war mit ihrem Latein am Ende. Der Rat des Alten, ein Stück Speck am Bindenfaden zu verschlucken, um es dann wieder hochzuziehen, erübrigte sich… Der Steuermann, ein Mann mit der etwas derben Ausdruckweise des ehemaligen Hochseefischers, gab mir auf meine verzweifelte Frage, was ich denn gegen mein Leiden tun könne, zur Antwort: „Nixs, min Jung, du schallst man blot uppassen; wenn de brune Ring hochkümmt, den musst du allweder schlucken, dat is dat Arschloch…“
Mittagszeit: Ich brauchte nichts, aber auch für die restliche Mannschaft, die klatschnass und halb erfroren von Deck herein getorkelt kam, gab es außer heißen Getränken auch nur kalte Küche. Sie hatten unter Lebensgefahr ein paar volle Zweihundert-Liter-Ölfässer, die am achteren Decksaufbau festgelascht waren und sich selbstständig zu machen drohten, wieder dingfest gemacht. Das bekam ich aber nur so am Rande mit; ich war ausschließlich mit mir selbst beschäftigt und war zu nichts zu gebrauchen. Ich weiß es noch, als ob es erst gestern gewesen wäre: Mich krampfhaft an irgend etwas festhaltend, starrte ich stundenlang durch das Kombüsenfenster auf die querab an Backbord auf und ab und hin und her tanzenden weißen Kreidefelsen von Mön – Möns Klinst. Das Schiff, das sich zu allen anderen Übeln auch noch schüttelte wie ein nasser Hund, wenn es die Nase tief wegsteckte und das Heck samt Schraube dabei kurz aus dem Wasser ragte und diese dann widerstandslos durchratterte, kam einfach nicht von der Stelle. Ich war verzweifelt und schwor bei allen Heiligen: Sobald wir auch nur wieder in die Nähe von Bremen kommen, mache ich einen großen Satz…
Irgendwie mussten wir während der Nacht doch noch vorangekommen sein, denn am darauf folgenden Morgen lag das Schiff – völlig ruhig gestellt – im Hafen von Malmö. Der Sturm hatte sich gelegt, aber nun verhinderte dichtes Schneetreiben das Öffnen der Ladeluke. Außerdem hatte sich noch kein Agent eingefunden, auch von den Schauerleuten war noch niemand zu sehen. Kräne und Schuppen trugen dicke weiße Hauben; es war auf einmal tiefster Winter.
Die Decksmannschaft – ein Matrose, ein Leichtmatrose, ein Jungmann und zwei „Mosese“ (d. h. selbstverständlich nur ein Moses, der andere Schiffsjunge, der bereits vor mir an Bord war, hatte die rote Laterne natürlich sofort an mich weitergegeben) – hatte sich in der Mannschaftsmesse unter Deck versammelt und – wärmte sich auf. Allerdings nicht nur mit Tee. Heini, der Matrose und Fiete, der Leichtmatrose, ehemalige Hansa-Fahrer, erinnerten sich an den Persischen Golf und schwärmten von einem Whisky-Schuppen in „Koramscha“. Jungmann Siegfried konnte da nicht mithalten; er war bislang nur in der „Kleinen Fahrt“ und hielt sich deshalb bescheiden zurück. Heiko, mein Vorgänger als Moses, frotzelte mich ungeniert wegen meines Totalausfalls. Diese freche Bremer Rotznase, ich würde es ihm schon noch einmal zeigen… Meine Lebensgeister hatten sich, dank Hannas körniger Brühe und mit etwas Pott-Rum im Tee, wieder zurückgemeldet. Ich war nun wieder bereit, den Kampf gegen die Elemente aufs Neue aufzunehmen.
Der ließ nicht lange auf sich warten. Nach dem Löschen der Ladung war als nächster Hafen Oskarshamn unser Ziel. Kaum, dass wir aus dem Sund heraus waren und unser Kurs sich erneut gen Osten richtete, wurden wir auch schon wieder von einem steifen, eisigen Wind gebeutelt und von kurzen, harten Wellen durchgeschüttelt. Ich aß trocken Brot und hing – nicht wieder über der Reling, sondern im Ruder. Genauer gesagt, im mannsgroßen, hölzernen, Messing beschlagenen Steuerrad. Die Haltezapfen der Speichen fest im Griff, versuchte ich das Unmögliche, nämlich: das Schiff auf Kurs zu halten. Die Ruderanlage der STADERSAND bestand aus einer höchst primitiven, rein mechanischen Kraftübertragung. Jeder etwas härtere Wellenschlag auf das Ruderblatt wirkte sich auf das Steuerrad wie eine Ohrfeige aus. Bei schwerem Wetter war es ein regelrechter Kampf gegen die Naturgewalten, und ich sollte es noch erleben, dass wir selbst mit drei Mann nicht in der Lage waren, das Ruder zu bändigen. Im Augenblick kam die See direkt von vorn. Das war relativ günstig zum Steuern. Ich musste nur aufpassen, den Kurs auch zu halten, um der groben See keine seitliche Angriffsfläche zu bieten. Als es dann doch passierte, versuchte ich, das plötzlich „durchdrehende“ Steuerrad abzubremsen, indem ich die flache Hand gegen den Messingbeschlag des Rades presste. Mit dem Erfolg, dass es mir die Hautfetzen vom Handballen nur so abzog… Nach einer Stunde härtesten Kampfes gegen die Unbilden der Natur und der Technik – die STADERSAND hatte selbstredend keinen Kreiselkompass, und der Magnetkompass, nach dem wir steuerten, befand sich über uns, sozusagen auf dem Dach der Brücke, dem Peildeck – wurde ich endlich abgelöst. Meine linke Hand schmerzte, mein Nacken schmerzte durch das ständige Hochgucken in eine Periskopröhre, in der sich der jeweilig präsente Kursausschnitt widerspiegelte. Meine total verkrampften Beinmuskeln schmerzten, und meine Arme – die spürte ich gar nicht mehr… Aber – und das merkte ich erst, als ich mich an meinem Ausguckplatz hinter einem der Brückenfenster verkeilt hatte und – bereits wieder würgend – in die schwarze, stockfinstere Nacht starrte – ich hatte, solange ich am Ruder stand – keine Zeit für die Seekrankheit gehabt…
Sechs lange Stunden dauert eine Wache auf einem Zwei-Wachen-Schiff. Drei Stunden davon stand ich am Ruder. Mein Eignungstest war demnach positiv ausgefallen. Hanna, der ich fürderhin nicht mehr zur Verfügung stand, war etwas verschnupft. Denn Heini, der alt gediente Matrose, der nun des lästigen Wachdienstes ledig war, half nicht beim Kartoffelschälen… Ich hingegen war nicht wenig stolz darauf, zusammen mit dem Jungmann Sigi auf der Kapitänswache, die von 06:00 h bis 12:00 h und von 18:00 h bis 24:00 h dauerte, zu sein.
Читать дальше