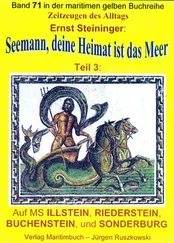… und von dem ich mir als erstes einen schicken, bunt gemusterten „Norweger“ kaufte und – dicke Wollsocken für die unvermeidlichen Gummistiefel. An so einen Luxus wie etwa Sicherheitsschuhe verschwendete man damals in der christlichen deutschen Schifffahrt noch keinen Gedanken. Ich natürlich auch nicht, Arbeitssicherheit war für mich damals ein völlig abstrakter Begriff. Die wichtigste Frage für mich hieß: Wie werde ich schnellstens seefest? Und dafür gab es leider keine verbindliche Antworten, nur leidvolle Erfahrungen. Eine dieser Erfahrungen war, dass man sich auf keinen Fall durchhängen lassen durfte, weil man sonst möglicherweise durchdrehte. So gesehen war es ganz gut, dass mir der nicht endende Wachdienst und das anstrengende Steuern, das ich schon ganz gut beherrschte, nur wenig Zeit für mitleidsvolle Selbstbetrachtungen ließen.
Meine zweite Seereise – ich war nun schon über einen Monat an Bord – ging zu Ende. Der Nord-Ostseekanal lag bereits hinter uns, und wir tuckerten unter Lotsenberatung die Elbe hinunter. Das Schiff zog ruhig durchs Wasser, mir ging es wieder gut, und so beschloss ich, doch noch eine nächste Reise zu versuchen. Der Alte, der sich wie üblich während der Kanalfahrt ausgeruht hatte, unterhielt sich gut gelaunt mit dem Lotsen im schönsten Platt über ditt und datt. Ich stand hinter’m Steuer und musste hören, wie der Alte zum Lotsen sagte: „Tja, un een Seppl heb wi ok on Bord“. – „Soso“ sagte der Lotse „kann he ok schon en betten Platt?“ – „Jau“ krähte ich ungefragt dazwischen „klei mi am Mors!“… Das war nun mal einer der ersten Sätze auf „Platt“, den ich inzwischen oft genug zu hören bekommen hatte, aber in diesem Fall kam es wohl nicht ganz so gut an; der Lotse drehte sich kurz nach mir um und musterte mich kalten Blickes…
In Bremen gab es für den Alten eine böse Überraschung: Die Charter war gekündigt worden. Böse deshalb, weil keine neue Charter in Sicht war und die STADERSAND in die „wilde Fahrt“ gehen sollte. Das bedeutete für Kapitän und Steuermann, dass sie nicht mehr mit festen Liegezeiten in Bremen rechnen konnten und somit ihr Familienleben darunter zu leiden hätte. Familienleben? Nun, das war mein Problem nicht. Im Gegenteil, ich freute mich auf die so genannte „wilde Fahrt“, weil sich mir ein weiterer Horizont auftat. Zuerst aber tat sich etwas anderes. Aus Einsparungsgründen – denn ab jetzt musste der Eigner selbst für sein Schiff aufkommen – wurden Hanna, die Köchin, und Heini, der alte Matrose, entlassen. Die Besatzung bestand jetzt aus dem Kapitän nebst Steuermann, dem Maschinisten Lottl, unterstützt von Manfred, dem Schmierer. An Deck hatte von nun an Fiete, der Leichtmatrose, das Sagen über Jungmann Siegfried und über Heiko und mich, die beiden Schiffsjungen. Die bange Frage aber war: Wer sollte wohl in Zukunft den Smutje machen?
Nach einer missglückten Proviantübernahme im Bremer Europahafen war diese lebenswichtige Frage erstmal vom Tisch. Wahrhaft, ein Malheur mit einschneidenden Folgen für die nächsten Wochen, denn der reiche Eigner des Schiffes, Reeder und Ziegeleibesitzer und weiß der Teufel was noch, verbat es sich, Proviant nachzubestellen. Was passiert war? Nun, als der Schiffshändler mit den bestellten Ausrüstungsgegenständen inclusive Proviant endlich am Liegeplatz eintraf, waren die Umschlagsarbeiten längst abgeschlossen. Zur Übernahme stand dann auch kein Kran mehr zur Verfügung. Zu diesem Übel kam noch, dass gerade Ebbe war, so dass von unserem mickrigen Schiff gerade mal die Mastspitzen über die Pier hinaus ragten. Auch das eigene Ladegeschirr war unter diesen Umständen nicht verwendbar. So fierten wir alle Gegenstände mit einem Tampen an den Spundwänden entlang einzeln aufs Bootsdeck hinunter. Oben an der Pier werkten die beiden Kräftigeren, Siegfried und Heiko, während Fiete und ich die Dinge in Empfang nahmen. Bei all den „unwichtigen“ Dingen, wie Farbe, grüne Seife, Piassavabesen klappte es auch vorzüglich: Die jeweilig speziell angebrachten Seemannsknoten hielten, was sie halten sollten. Auch die vollen Bierkisten für den Steuermann, all die wichtigen Spirituosen und Zigaretten kamen unten an. Nur ausgerechnet bei der unförmig großen Proviantschachtel, in der sich die guten Sachen wie Kaffee, Tee, Dosenmilch, Dosenwurst, Dosengemüse, Dosenobst etc. befanden – ausgerechnet bei der löste sich der sonst zuverlässige „Zimmermannssteg“ vorzeitig, und die Schachtel landete, am Heck knapp vorbei, im „Bach“. Und noch bevor wir richtig begriffen, was passiert war, versank das Fresspaket vor unseren verdutzten Blicken im verdreckten, schmutzigbraunen Hafenwasser…
Genau genommen, so hart wie die anderen, traf mich das nicht. Auch ohne seekrank zu sein, ekelte es mich vor solchen Delikatessen wie „Schlimme-Augen-Wurst“, „Jagdwurst“, grobschlächtige Sülze… Was mich dann jedoch voll traf war, dass ich, zusätzlich zum Wachdienst, den Koch machen sollte. Wieder ich, immer ich, das war doch echt zum Kotzen. Mein erstes Essen aber, dass fanden dann die anderen zum Kotzen bzw. nicht essbar. Ich hatte mich, ob ich nun wollte oder nicht, an frischen Bratwürsten – in Brunsbüttel eingekauft – zu vergehen. Dazu sollte es noch Kartoffelpüree mit Sauerkraut geben. Aber mir fehlte nicht nur der gute Wille, sondern wohl auch das richtige Händchen für die Hohe Schule der Kochkunst. Die vordem saftigen, noch dazu privat erstandenen Bratwürste glichen nach meiner Behandlung dürren, saftlosen Hundeködls, und das Püree hatte die Konsistenz von Kernseife. Lediglich das Sauerkraut blieb als einigermaßen genießbar übrig. Das alleine aber rettete mich nicht vor dem vernichtenden Urteil der gesamten Mannschaft. Ich wurde ab sofort für immer aus der Kombüse verbannt – was mir nur recht war. In der Folge versuchte sich abwechselnd mehr schlecht als recht der eine oder andere als Kochkünstler. Irgendwann stellten wir unisono fest, dass ausgerechnet der pickelige, schmierige, stets nach Gasöl stinkende Manfred das noch am ehesten genießbare Essen zubereitete…
Da mir der herbe „Bünting“-Tee ebenso wenig zusagte wie der den Magen zersetzende Muckefuck, mixte ich mir so zwischendurch, sehr zum Ärger meiner Kollegen, gerne einen „Drink“ aus Dosenmilch und heißem Wasser, den ich mir mit Zucker versüßte. Dosenmilch und Zucker waren aber, seit das Schiff auf eigene Rechnung fuhr, streng rationiert. So wachte jeder neidvoll über die „Völlerei“ des anderen. Zwistigkeiten deswegen waren schier unvermeidbar. Es kam so, wie es kommen musste: Heiko und ich wurden deshalb handgreiflich, und ich schüttete ihm zornentbrannt das bereits im Keramikbecher befindliche heiße Wasser vor den Latz. Heiko holte aus, ich sprang, dem Schlag ausweichend, auf die mir aus der Hand gefallene Muck. Unglücklicherweise war der oberste Rand der Muck abgesprungen und der nun scharfkantige Becherrand bohrte sich in die nackte Sohle meines rechten Fußes.
Als dies passierte, war es längst Sommer geworden. Ich war die längste Zeit schon seefest und natürlich auch längstens ein vollwertiges Besatzungsmitglied. Aus diesem Grund, nehme ich an, nahm es der Kapitän auf sich, für mich im nächsten Hafen einen Arzt an Bord zu bestellen. Unser Bestimmungshafen war Gent, und irgendwo während der Kanalfahrt dahin machte das Schiff deswegen an irgendwelchen Dalben fest. Es gab keine feste Landverbindung, der kleine, rundliche Doktor musste über ein schmales, schwingendes Etwas – wobei ihm prompt seine Arzttasche „in den Bach“ fiel… Der gute Mann ließ sich aber nicht entmutigen, besorgte sich Ersatz und hatte dann größte Mühe, meine zerschnittene Fußsohle irgendwie zusammenzuflicken. Meine Fußsohlen waren durch das bequeme Barfußlaufen auf dem Eisendeck zäh wie Schweineleder geworden. Der kleine Doktor bemühte sich redlich. Bald rannen ihm die Schweißperlen von der Stirn, während er die halbmondförmigen Nadeln mit einer Kombizange durch die Hornhaut zog. Eine nach der anderen ging dabei entzwei. Meine Kameraden, die ihm neugierig über die Schulter sahen, sparten unter johlendem Gelächter nicht mit fachlichen Ratschlägen. Und ich – durch das vorherige Vereisen spürte ich ja nichts – ich grinste dämlich…
Читать дальше