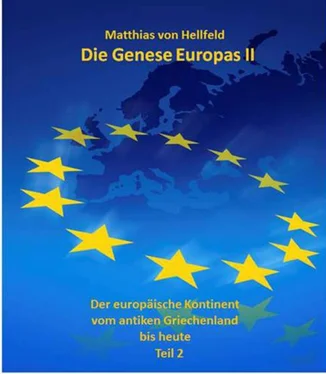1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Im 11. Jahrhundert stoßen islamische Seldschuken, eine türkische Fürstendynastie, immer weiter nach Süden vor und nehmen 1055 Bagdad und anschließend den gesamten Irak, weite Teile Persiens, Syrien und Zypern ein. Ihre Hauptstadt heißt Rey – etwas mehr als 10 Kilometer vom heutigen Teheran entfernt. Von dort organisieren sie ihre Herrschaft über weite Teile des Vorderen Orients und des Nahen Ostens. Palästina und Jerusalem gehören also zum islamischen Herrschaftsgebiet. Dieser Umstand löst bei den frommen Christenmenschen in Europa Zorn aus, schließlich beanspruchen Christen und Juden das Heilige Land mit Jerusalem als spirituellen Mittelpunkt ihrer Religionen für sich. Zudem erschrecken Meldungen, die Hauptstadt des mächtigen Byzantinischen Reiches – Konstantinopel – könne sich den islamischen Seldschuken kaum noch erwehren. Damit ist zum ersten Mal ein christliches Reich von islamischen Eroberern existenziell bedroht.
Weltliche Macht vs. Geistliche Macht
Diese für die christlichen Kirchen missliche Lage bringt am Beginn des 11. Jahrhunderts für die Päpste in Rom eine entscheidende Frage auf, deren Beantwortung die europäische Welt für mehr als zwei Jahrhunderte in Atem halten soll: Wenn die christliche Kirche das nach ihr benannte Abendland geprägt hat, was ist dann mit dem Rest der damals bekannten Welt? Soll auch dort der lange Arm des Vatikans hinreichen und kann die geistliche Macht Könige und Kaiser veranlassen, gegen die Muslime in einen Krieg zu ziehen, um die frohe Botschaft der Bibel auch bei denen zu verkünden, die offensichtlich nichts davon wissen wollen? Die Antworten auf diese Fragen werden nicht in einem akademischen Disput gefunden, sondern in blutigen Schlachten.
Die Päpste streben auch nach weltlicher Macht, das haben sie immer wieder gezeigt. Aber wer hat denn nun das Sagen in Europa? Kaiser und Könige haben zwar Armeen und deshalb die unbestrittene weltliche Macht. In der damaligen Vorstellungswelt müssen sie aber auch göttlichen Segen haben, den aber nur der Papst – als Stellvertreter Gottes auf Erden – erteilen kann. Die Päpste haben zwar die geistliche Macht, sind aber ohne militärische Hilfe schutz- und hilflos. Sie können nur den Alleinvertretungsanspruch Gottes auf Erden in die Waagschale werfen. Es geht also um die Frage, welchen Einfluss kann die weltliche Macht der geistlichen zubilligen, ohne sich überflüssig zu machen? Und umgekehrt: Wie viel weltlicher Einfluss auf die Entscheidungen der Kirche ist dem Ansehen des Papstes noch zuträglich?
Die Suche nach Antworten auf diese spannenden Fragen beginnt in Goslar am 11. November 1050, als Heinrich IV. (1050 – 1106), der Sohn Kaiser Heinrich III., das Licht der Welt erblickt und schon als Vierjähriger auf Wunsch seines Vaters zum König gekrönt wird. Als Heinrich III. zwei Jahre später stirbt, muss der nun sechsjährige Heinrich seine Nachfolge antreten, was natürlich ohne Vormund nicht zu bewerkstelligen ist. Diese Situation provoziert Begehrlichkeiten bei einigen sächsischen Fürsten, die das Machtvakuum für sich nutzen wollen. Unter der Führung des Kölner Erzbischofs Anno II. (ca. 1010 – 1075) wird eine Verschwörung der Fürsten gegen den minderjährigen König und dessen vollkommen überforderte Mutter Agnes von Poitou (1025 – 1077) organisiert.
Im Frühjahr 1062 kommt es in Kaiserswerth bei Düsseldorf zu einer regelrechten Posse, die heute Wochen lang die Schlagzeilen der Boulevardpresse füllen würde: Der inzwischen 12-Jährige Heinrich IV. wohnt kurz nach Ostern einem großen Fest bei, als zur Überraschung der versammelten Gäste plötzlich der prunkvoll gekleidete Kölner Erzbischof Anno II. mit seinem Gefolge erscheint und sich unter die illustre Gästeschar mischt. Nach dem Ende der offiziellen Feierlichkeiten lädt der Erzbischof den Knaben auf eines seiner prächtigen Schiffe ein. Aber diese als Besichtigung getarnte Einladung entpuppt sich rasch als Entführung, denn kaum hat Heinrich IV. das Boot betreten, legt es ab und steuert auf die Strommitte zu. Der verängstigte junge König hechtet über Bord und versucht schwimmend das Ufer zu erreichen, wird aber von seinen Entführern wieder aus dem Wasser gezogen und ins benachbarte Köln verschleppt. Kaiserin Agnes von Poitou muss dem Treiben hilflos vom Ufer aus zusehen. Den Staatsstreich des frommen Gottesmanns kann sie nicht verhindern: Sie ist entmachtet und Anno II. führt die politischen Geschäfte im Reich.
Aber nicht lange, denn Anno II. von Köln gerät bald selbst in ein Gemisch aus Intrigen und Denunziationen und wird schließlich von Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen (ca. 1000 – 1072) als Vormund des immer noch unmündigen Königs Heinrich IV. abgelöst. Adalbert scheint übrigens das Vertrauen des jungen Mannes erhalten zu haben, denn als Heinrich IV. im März 1065 endlich selbst regieren darf, bleibt Erzbischof Adalbert auch weiterhin sein Berater. Ein Jahr später bekommt Heinrich IV. auf dem Reichstag zu Tribur die Macht der Fürsten zu spüren, denn sie zwingen ihn, jenen Adalbert von Hamburg-Bremen aus dem Amt zu jagen, und drohen unverhohlen ihn zu entmachten. Die reale Macht des Königs der Deutschen hat zwar existiert – aber eben nur wenn die Fürsten einverstanden sind. Da seine Mutter, Kaiserin Agnes von Poitou, nach dem Entführungsfall von Kaiserswerth ihren gesamten Besitz hat abgeben müssen, ist nun auch Heinrich VI. ohne ein eigenes Herzogtum – und mehr denn je auf die Territorialherren im deutschen Reich angewiesen.
Derartige Schwierigkeiten sind auf der anderen Seite des Rheins im westfränkischen Teil des alten Karlsreiches – in Frankreich - weitgehend unbekannt. Dort regiert mit Philipp I. (1052 – 1108) ebenfalls ein Minderjähriger. Philipp I. ist als Siebenjähriger zu Pfingsten 1059 gekrönt worden. Auch sein Vater ist früh gestorben, auch für ihn ist ein Vormund bestellt worden. Danach aber hören die Gemeinsamkeiten beidseits des Rheins auf, denn sobald Philipp I. selbst regieren kann, beginnt er den königlichen Einfluss gegenüber den mächtigen Fürsten auszubauen. Im Gegensatz zu Heinrich IV. gelingt es ihm, die Krondomäne, also das Gebiet, in dem ausschließlich er – der König – das Sagen hat, zu erweitern. Seine Nachfolger werden diesen Prozess fortführen und so den Grundstein für das zentralistisch organisierte Frankreich von heute legen. Außenpolitisch steht für Philipp I. die militärische Auseinandersetzung mit dem englischen Königreich ganz oben auf der Tagesordnung. Dieser Konflikt prägt die Politik der französischen Monarchie für viele Jahre und lässt verlustreiche Kriege über das Land ziehen. Philipps I. schwerste politische Bedrohung kommt von außen und nicht von einer inneren Opposition, die ihm den königlichen Thron streitig macht. Das unterscheidet ihn von seinem nahezu gleichalten Pendant im Ostteil des ehemaligen Frankenreichs.
Gregor VII.
Während beiderseits des Rheins die jugendlichen Könige um Macht und Einfluss mit den Territorialfürsten ringen, wird in Rom am 30. Juni 1073 mit dem Mönch Hildebrand ein Mann als Papst Gregor VII. (1025 – 1085) in sein heiliges Amt eingeführt, der im Vatikan schon seit langem eine zentrale Figur ist. Noch während der Begräbnisfeierlichkeiten für Alexander II. (1010 – 1073) kommt es im Vatikan zu tumultartigen Auseinandersetzungen, weil Hildebrand seine Wahl gegen ein Papstwahldekret und mit Hilfe eines demagogisches Kardinal durchsetze will. Jener Kardinal hat ihn vor der Kirche S. Pietro in Vincoli einfach durch das Volk ausrufen lassen. Der Mönch Hildebrand rechtfertigt sich später, ihm sei keine Zeit zum „Sprechen und Überlegen“ geblieben, weil die Menschen „wie die Wahnsinnigen auf ihn zugestürmt“ seien. Egal wie: Der im Vatikan nicht sonderlich beliebte Gregor VII. ist seit 1059 als Vermögensverwalter der römischen Kirche und Mitglied des Kardinalskollegiums der wichtigste Mann im Kirchenstaat. Die Archive des Vatikans stehen ihm ebenso offen wie ihm die Berichte über die erschreckenden Zustände der so genannten „Pornokratie“ während des 10. Jahrhunderts bekannt sind. All das bestärkt ihn darin, den Kampf gegen die Verweltlichung der römischen Kurie aufzunehmen. Seine Aufgabe sieht der neue Papst in der geistigen und vor allem geistlichen Erneuerung des Klerus, den er aus der Umarmung durch die weltliche Macht befreien will.
Читать дальше