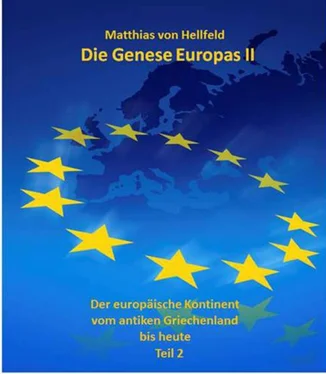Mit dem Beginn des 11. Jahrhunderts ist noch eine Entscheidung gefallen: Europa wird christlich geprägt sein. Einzig in Süditalien und in Spanien behindern muslimische Besetzungen das weitere Vordringen des Christentums. Spanien wird in den kommenden Jahrhunderten – ausgehend von der Grenzmark Karls „des Großen“ – Stück für Stück „zurückerobert“. In Sizilien ist die nicht-christliche Herrschaft ebenfalls zeitlich begrenzt und die „heidnischen“ Normannenherzöge im Nordwesten Frankreichs nehmen den christlichen Glauben an. Auch wenn es in Europa oft genug ganz und gar unchristlich zugehen wird, sind christliche Moralvorstellungen und Verhaltenscodizes das gemeinsame Bindemittel aller europäischen Völker.
England
Aber nicht nur die Mitte des europäischen Kontinents nimmt allmählich die Strukturen an, die uns heute noch geläufig sind. Angelsächsische Germanenstämme haben während der Völkerwanderung die britischen Inseln aufgesucht und besetzt. In den folgenden Jahren prallen dort christliche und heidnische Bräuche aufeinander, die erst mit einer Synode im Jahr 664 insofern beigelegt werden können, als die Angelsachsen ihre tradierten Bräuchen gegen die römische Kirchenordnung tauschen. In den kommenden Jahren ist die englische Kirche dem Vatikan treu ergeben, später wird es Schwierigkeiten zwischen der „anglikanischen Kirche“ und dem Papst in Rom geben. Mit Beginn des 9. Jahrhunderts aber ist die Christianisierung der Insel abgeschlossen, gleichwohl gewisse heidnische Rituale noch einige Zeit überlebt haben.
Von Dänemark kommend erscheinen 793 die ersten Wikinger in England. Die Wikinger haben einen erstaunlichen Siegeszug durch Europa hingelegt und sind dabei bis Kiew und hinter die Wolga gekommen. Zunächst setzen die Wikinger die Menschen auf der Insel in Angst und Schrecken, weil sie plündernd und marodierend durch das Land ziehen. Aber allmählich verändern die Wikinger ihre Strategie. Sie ziehen sich nach ihren Raubzügen nicht mehr zurück, sondern bleiben in England, gründen erste Siedlungen und fordern von den Nachbarn Tributzahlungen. 866 landet ein großes dänisches Heer in England, drei Jahre später stehen dänische Krieger über die Themse kommend vor den Toren Londons.
In den folgenden Jahren ist es immer wieder zu Kämpfen zwischen den einheimischen Königen und den Wikingern gekommen. In den meisten Fällen gehen die Kämpfe für die englischen Heere schlecht aus, im Umkehrschluss aber entsteht ein erstes Gemeinsamkeitsgefühl der Bewohner der britischen Inseln. Nach einigen Jahren, in denen sich Einheimische und Wikinger eigene Einflussgebiete zugesichert und geachtet haben, beginnt 980 eine zweite Welle von Wikingerangriffen. Die Angriffe erfolgen auf dem Seeweg, wo die Wikinger den Engländern weit überlegen sind. Die Engländer müssen sich der Übermacht beugen, akzeptieren hohe Tributzahlungen und legen schließlich noch einmal viel Gold und Silber auf den Tisch, um den Abzug der Wikinger zu erkaufen.
Der englische König Aethelred II. (968 – 1016) hat die Auseinandersetzung mit den Wikingern mit besonderem persönlichem Einsatz geführt, indem er die Tochter eines in der nordfranzösischen Normandie residierenden normannischen Herzogs heiratet. So gestärkt vollführt Aethelred II. ein Massaker an allen Dänen, derer er habhaft werden kann. Das Ergebnis ist eine Katastrophe, denn er muss fliehen, die Wikinger verstärken wieder ihre Angriffe und Aethelred II. hat den Grundstein gelegt, der wenige Jahre später zur Eroberung Englands durch die Normannen führen sollte. Nach seinem Tod wird der dänische König Knut „der Große“ (995 – 1035) Herrscher in England. Knut ist König von Dänemark, England, Norwegen und Südschweden in Personalunion.
Spanien
In Spanien herrscht das Emirat von Cordoba, obwohl es im 9. und 10. Jahrhundert zu schweren innermuslimischen Konflikte gekommen ist. Zeitweise stellen diese Konflikte den Bestand des Emirats in Frage. Erst als es dem achten Emir Rahman III. (889 – 961) gelingt, mehrere Revolten gegen die muslimische Herrschaft in Spanien niederzuschlagen und er zudem Al-Andalus – das heutige Andalusien – befrieden kann, gründet er das Kalifat von Cordoba. Aus dem Emirat, also einem fürstlichen Herrschaftsbereich, wird ein Kalifat, wo geistliche und weltliche Führung in der Person des Kalifen vereinigt sind. Aber es gibt auch Widerstand gegen die muslimische Besatzung Spaniens. Insbesondere im Norden an der Grenze zum Frankenreich etabliert sich mit Asturien das erste christliche Königreich, das nach der Verlegung der Hauptstadt von Oviedo nach Leon und einigen dynastischen Wirren 925 als Königreich Leon weiter existiert. Aber die christlichen Reiche in Kastilien, Navarra, Aragon oder Barcelona kämpften nicht nur gegen die Übermacht der Muslime des Kalifats von Cordoba, sondern auch sehr viel und sehr gerne gegeneinander.
Kirchenschisma
Im Vatikan durchleben die Päpste zu Beginn des 11. Jahrhunderts eine schwierige Phase. Es zeichnen sich immer deutlicher unüberwindliche Schwierigkeiten mit den christlichen Glaubensbrüdern im Byzantinischen Reich ab. Die Gegensätze zwischen den Päpsten in Rom und den Patriarchen in Konstantinopel sind vor allem machtpolitischer Natur. Leo IX. (1002 – 1054), der bedeutendste deutsche Papst des Mittelalters, hat sich als Reformer einen Namen gemacht. Er hat Priesterehe, Ämterhäufung und das Recht weltlicher Herrscher geistliche Würdenträger in ihre Ämter zu berufen - die so genannte Laieninvestitur - bekämpft. Der deutsche Papst verordnet der päpstlichen Verwaltung grundlegende Veränderungen und holt zahlreiche Reformer nach Rom. Die gregorianischen Reformen werden unter seinem Pontifikat weiter geführt und das Kardinalskollegium begründet, das bis heute als höchstes päpstliches Beratergremium fungiert. Aber Leos IX. Amtszeit ist überschattet von einem Dogmenstreit zwischen der Westkirche, deren Oberhaupt er ist, und der Ostkirche, die der Patriarch von Konstantinopel, Michael I. Kerullarios (1000 – 1059), führt. Die beiden nebeneinander existierenden Kirchen unterscheiden sich vor allem in den Auffassungen über die richtige Liturgie und die kirchlichen Dogmen. Anfang 1054 wird klar, dass sowohl Papst Leo IX. als auch das Oberhaupt der oströmischen Kirche den Führungsanspruch über die Christenheit für sich beanspruchen.
Kurz nach dem Tod Leos IX. kommt es im Juli 1054 schließlich zum endgültigen Zerwürfnis zwischen der römischen und der byzantinischen Kirche, als der päpstliche Abgesandte Kardinal Humbert von Silva Candida (1006 – 1061) nach Konstantinopel reist, um den in seinen Augen abtrünnigen Patriarchen zu bekehren. Als das misslingt, knallt er am 16. Juli 1054 eine päpstliche Bannbulle gegen Michael I. Kerullarios auf den Altar der Hagia Sophia und provoziert damit seinen eigenen Bann. Dieser ursprünglich nur auf zwei – ebenso unnachgiebige wie arrogante - Personen bezogene Bannfluch spaltet die christliche Kirche endgültig. Trotz vielfacher Versuche, die Spaltung zu überwinden, hat das Schisma bis heute Bestand.
Die Welt der mittelalterlichen Christen ist fortan in zwei Hälften auseinandergefallen. Während der europäische Kontinent weitgehend unter dem Einfluss der römischen Kirche steht, werden das byzantinische Reich und weite Teile Osteuropas und Asiens von der orthodoxen Kirche des Patriarchen von Konstantinopel geprägt. Auch wenn sie fortan getrennte Wege gehen, beobachten die beiden christlichen Kirchen mit zunehmender Sorge die weitere Ausbreitung des Islam. Beide Kirchen haben ihr religiöses Zentrum mit dem Geburtsort Jesu in einer Gegend, die immer mehr von islamischen Staaten beherrscht wird: Palästina. Aber rundum Jerusalem haben sich muslimische Staaten etabliert: das Aijubidenreich, das Reich der Hülagiden, das Sultanat der Seldschuken oder Kleinarmenien. Damit stellen islamische Staaten eine latente Bedrohung für die Christenheit dar, weil sie offenbar auf Expansion aus sind.
Читать дальше