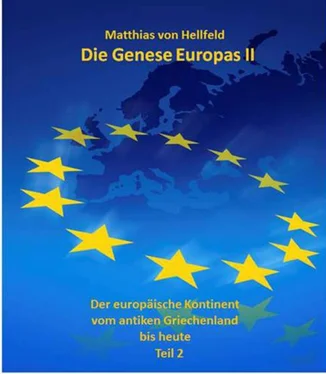Canossa
Nun bleibt Heinrich IV. keine andere Wahl mehr, als zum Bußgang anzutreten. Doch er hat die Rechnung ohne die grimmige Entschlossenheit der Fürsten gemacht, die ihn unter allen Umständen absetzen wollen. Ohne den König zu informieren, laden sie Gregor VII. nach Augsburg ein, wo er über das Schicksal Heinrichs IV. entscheiden soll. Ein durchsichtiges Vorhaben, denn welche Entscheidung würde der Papst wohl treffen? Als Datum für die Durchführung dieses Plans ist der 2. Februar 1077 vorgesehen. Gregor VII. macht sich sofort auf den Weg von Rom nach Süddeutschland. Zur gleichen Zeit - aber in umgekehrter Richtung – bricht auch Heinrich IV. auf. Mit kleinem Gefolge überquert er die Alpen, um zum Papst nach Rom zu gelangen.
In der Emilia Romagna in der Nähe von Modena kommt es schließlich zum Show-down im Schnee. Gregor VII. erfährt von der Reise Heinrichs IV. und lässt sich von seiner Reisebegleiterin Mathilde von Tuszien (1046 – 1115) überreden, den Kaiser zu empfangen. Ort des Geschehens am 28. Januar 1077 ist die Burg Canossa, die Mathilde gehört. Dort legt Heinrich IV. seinen Eid ab, nachdem er angeblich im Büßergewand ohne königlichen Schmuck drei Tage barfuß im Schnee seine offensichtliche Reue dargeboten haben soll. Der Papst befreit ihn vom Bann und nimmt den Reumütigen wieder in die Kirchengemeinde auf, nachdem die Bedingungen geklärt sind: Der Papst bestimmt zukünftig allein über die Besetzung von Kirchenämtern, außerdem müssen sämtliche während des Streits konfiszierten Kirchengüter zurückgegeben werden und der Kaiser muss Treue gegenüber der „heiligen römischen Kirche“ schwören. Da diese mit einem Schwur verbundenen Bedingungen nicht personalisiert werden, gelten sie auch für alle Nachfolger Heinrichs IV. Das ist zweifellos ein demütigender Augenblick für den König gewesen, der durch seinen Bußgang der Oberaufsicht des Papstes über die weltliche Herrschaft zustimmt und dem Königtum einen schweren Imageschaden zufügt. Mit seiner Unterwerfung akzeptiert Heinrich IV. die päpstliche Strafgewalt nicht nur über sich, sondern auch über sein Amt. Aber es bleibt ihm keine andere Wahl, denn ohne seinen sprichwörtlichen „Gang nach Canossa“ hätte er gegen die heimische Fürstenopposition keine Chance mehr gehabt. Heinrich IV. wird durch den Reformeifer des Papstes eine schmähliche Niederlage beigebracht und seine Position gegenüber den Fürsten und Herzögen des Reiches ist nachhaltig geschwächt.
Während Heinrich IV. geschwächt aus dem Konflikt mit dem Papst herausgeht, sieht sein französischer Amtskollege Philipp I. (1052 – 1108) den apostolischen Reformen gelassen entgegen. Er und seine Vorgänger haben sich sehr viel weniger in kirchliche Belange eingemischt, eine Art Reichskirchensystem mit der engen Verzahnung von Kirche und Krone gibt es in Frankreich nicht. Nur in ein paar Dutzend Fällen hat der französische König die Wahl von Bischöfen beeinflusst. Philipp I. stimmt den Reformen der Kirche in seinem Reich zu, weil seine Interessen davon kaum tangiert werden. Heinrich IV. dürfte neidisch über die Ufer des Rheins geblickt haben, denn für ihn kommt es noch schlimmer. Trotz der Aufhebung des Bannes wird am 15. März 1077 in Forchheim bei Nürnberg Rudolf von Rheinfelden zum Gegenkönig gewählt. Bei dieser Auseinandersetzung kann Heinrich IV. wieder fest mit einem Gegner rechnen: Gregor VII. Der Papst schlägt sich auf die Seite von Rudolf, erneuert den gerade aufgehobenen Bann gegen König Heinrich IV., setzt ihn zum zweiten Mal ab und löst den Treueeid seiner Untertanen erneut auf.
Doch Rudolf von Rheinfelden stirbt Mitte Oktober 1080 in der Schlacht von Hohenmölsen. Das nutzt Heinrich IV. sofort aus, bricht nach Rom auf und belagert die Stadt drei Jahre lang. 1083 setzt er seinerseits Gregor VII. ab und hievt auf der Synode von Brixen einen gewissen Wibert von Ravenna als Clemens III. (1020 – 1100) auf den apostolischen Stuhl in Rom. Von Clemens III. lässt sich Heinrich IV. Ende März 1084 im Gegenzug zum römischen Kaiser krönen. Damit scheinen sich die Ereignisse für Heinrich IV. doch noch zum Guten gewendet zu haben. Aber der im Jahr zuvor seines Amtes enthobene Gregor VII. bekommt 1084 Hilfe vom Heer des Normannenführers Robert Guiskard (1015 – 1085), der sich in Sizilien festgesetzt hat. Beim Anblick der Truppen des Normannenherzogs müssen sich die kaiserlichen Truppen Heinrichs IV. aus Rom zurückziehen. Es stellt sich jedoch heraus, dass die als Befreier des abgesetzten Papstes herbeigesehnten Normannen lieber die Stadt plündern als sie zu verteidigen. Zum Entsetzen Gregors VII. verkehrt sich also sein Plan ins Gegenteil. Wie einst der römische Kaiser Nero steckt Guiskard die halbe Stadt in Brand und zieht unbekümmert von dannen, nicht ohne Gregor VII. mitzunehmen. In Salerno lässt er den ehemaligen apostolischen Oberhirten laufen. Am 25. Mai 1085 stirbt Gregor VII.
Die Schlacht von Manzikert
1055 erobern die Seldschuken Bagdad. Es scheint unvermeidlich, dass ihr Zug weiter nach Konstantinopel, dem Zentrum des byzantinischen Reichs, gehen würde. Der byzantinische Kaiser Romanos IV. (ca. 1010 – 1072) schickt angesichts dieser bedrohlichen Lage Hilferufe nach Europa, um christliche Ritter zu ermuntern, sich für die Verteidigung des ebenfalls christlichen Teils des alten oströmischen Reichs einzusetzen. Und tatsächlich folgen viele Ritter vor allem aus Frankreich dem Ruf und stellen sich an die Seite des bedrängten Kaisers von Byzanz. Aber die Niederlage in der entscheidenden Schlacht um die künftigen Einflussgebiete der christlichen und der islamischen Religion können sie am 26. August 1071 in der Nähe der kleinen Stadt Manzikert in Ostanatolien in der heutigen türkischen Provinz Mus nicht verhindern.
Als die beiden Heere aufeinander treffen, ist der Ausgang indes schon klar, denn auf Seiten der Byzantiner gibt es Verrat und die militärische Führung hat es versäumt, genaue Aufklärung über die Beschaffenheit des Geländes und über die Stärke des Gegners zu betreiben. Am Ende der Schlacht gerät der „heldenhaft“ kämpfende byzantinische Kaiser Romanos IV. in Gefangenschaft. Die Niederlage seines Heeres hat weltpolitische Bedeutung, denn nach der Schlacht von Manzikert beginnt der allmähliche Untergang des Byzantinischen Reiches. Gleichzeitig brechen in Bulgarien und Serbien Aufstände aus und Kleinasien wird türkisch. Mit der Schlacht von Manzikert ist entschieden, dass diese Gegend der Erde islamisch werden und deswegen immer wieder in Gegensatz zum „christlichen Abendland“ geraten würde.
Obwohl der geopolitische Europabegriff im Mittelalter keine große Bedeutung erlangt hat, entfaltet die Wahrnehmung des Fremden eine für Europa identitätsstiftende Wirkung. Denn immer mehr gleicht die Demarkationslinie zwischen der christlichen und der islamischen Welt auch einer Identitätslinie für die Menschen. Jene, die auf dem europäischen Kontinent leben, empfinden sich mehr und mehr als Angehörige des „christlichen Abendlands“ und grenzen sich so von denen ab, die nicht auf ihm leben. Dieser Prozess der Identitätsentwicklung gilt natürlich für beide Seiten, denn auch die Muslime empfinden die Auseinandersetzung mit den Christen als identitätsstiftend. Auf dem europäischen Kontinent beginnt im 11. Jahrhundert ein vielschichtiger Prozess, in dem antike, heidnische, jüdische und christliche Wurzeln miteinander verschmelzen und einen speziellen europäischen Zivilisationsraum entstehen lassen, so jedenfalls die Schlussfolgerung von Monika Franz 2004. Entlang der Religionsgrenze findet die „Geburt Europas“ statt. Durch die Konfrontation mit Nicht-Christen bildet sich eine spezifische europäische Mentalität heraus, wobei das Mittelalter die Genese, gleichsam Geburt und Kinderstube, Europas gewesen ist, „ohne dass die Menschen jener Jahrhunderte die Idee oder den Willen gehabt hätten, ein einheitliches Europa zu schaffen“, so formuliert es Jacques Le Goff in seinem 2004 erschienen Buch „Die Geburt Europas“.
Читать дальше