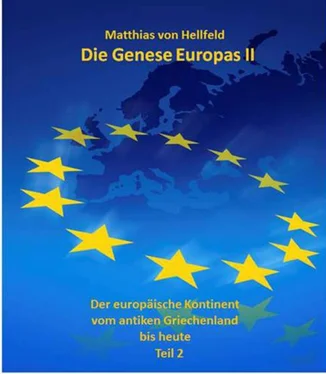Anlässlich einer Fastensynode im Februar 1075 sagt Gregor VII. dann der weltlichen Macht im christlichen Abendland endgültig den Kampf an. Die weltliche soll sich der geistlichen Macht unterordnen. Damit soll die römische Kurie wieder zu dem werden, was sie eigentlich ist: Zentrum eines den europäischen Kontinent einenden christlichen Glaubens und nicht willfähriger Steigbügelhalter der weltlichen Macht – so wie es Horst Fuhrmann in seinem 1998 erschienen Buch über die Päpste geschrieben hat. Das Sagen über die Welt – und das ist in der mittelalterlichen Vorstellungswelt gleichbedeutend mit Europa - soll der mit göttlicher Mission ausgestattete Papst haben. Deswegen definiert Gregor VII. die Funktion der Bischöfe und Priester neu. Wenn er, der Papst, der Stellvertreter Christi auf Erden ist, so sollen fortan die Bischöfe und Priester die Stellvertreter des Papstes sein. Nur der Papst soll deshalb künftig das Recht haben, kirchliche Würdenträger in ihre Ämter zu bringen. Priester und Bischöfe sollen sich in Zukunft nicht weltlichen Problemen widmen, sondern sich wieder auf die Verkündigung von Gottes Wort konzentrieren. Es soll dem Papst vorbehalten sein, zu entscheiden, wer die einflussreichen Bistümer leitet und wer die durch päpstliche Interpretation bestimmte Verbreitung der christlichen Lehre in Europa organisiert. Glauben soll fortan heißen, dem Papst zu gehorchen!
Diesem Prinzip widerspricht die bis dahin geübte Praxis der so genannten „Laieninvestitur“. „Laieninvestitur" bezeichnet das Recht eines Königs Bischofsämter oder andere kirchliche Positionen vergeben zu können. Dem König ist es auch erlaubt gewesen, den Bischofsstab und den dazugehörigen Ring zu verleihen. Auf dieser Basis haben die weltliche und die geistliche Macht ein Bündnis geschlossen – zum Wohle beider Seiten. Die so durch den König eingesetzten Bischöfe und Äbte haben sich zum stabilen Machtfaktor entwickelt und den deutschen Königen seit Otto „dem Großen“ einen effizienten Herrschafts- und Verwaltungsapparat geschaffen, der ohne ihre Hilfe nicht funktionieren würde. Gregor VII. ist all das zuwider, er will die Macht des weltlichen Herrschers brechen und die „Laieninvestitur“ unterbinden. Der Konflikt wird mit harten Bandagen geführt, Papst und Kaiser schrecken nicht davor zurück, Ansehen und Macht in die Waagschale zu werfen. Gregor VII. verbietet auf besagter Fastensynode in Rom die gängige Ernennungspraxis und degradiert damit die Könige zu ganz gewöhnlichen Laien, die in Zukunft weder Bischöfe noch Priester oder Äbte in ihre Ämter einsetzen dürfen. Die Abschaffung dieses Privilegs ist für Heinrich IV. ein Angriff auf seine königliche Würde, die nicht unbeantwortet bleiben darf. Damit beginnt der so genannte „Investiturstreit“.
Der Investiturstreit
Wie wichtig dem Papst diese Veränderungsabsichten gewesen sind, kann man einem Papier entnehmen, das den Titel „dictatus papae“, also „Diktat des Papstes“, trägt. Der Text findet sich im päpstlichen Briefregister, ist aber nicht veröffentlicht worden. Es könnte also sein, dass es sich lediglich um das Gedächtnisprotokoll einer geheimen Sitzung im März 1075 handelt, bei der im Vatikan die weitere Vorgehensweise Gregors VII. besprochen worden ist:
„Er (der Papst) allein kann Bischöfe absetzen und wieder einsetzen.
Er allein darf nach Maßgabe der Zeitumstände neue Gesetze erlassen, neue Völker vereinen, aus einer Kanonie eine Abtei machen und umgekehrt, ein reiches Bistum teilen und arme zusammenlegen.
Ihm allein steht die Verfügung über die kaiserlichen Insignien zu.
Einzig des Papstes Füße müssen alle Fürsten küssen.
Er kann den Kaiser absetzen.
Sein Urteilsspruch kann von niemand aufgehoben werden, während er allein alle anderen Urteile aufheben kann.
Er kann die Untertanen von der Treue gegen Böse entbinden.“
Dieses „päpstliche Diktat“ ist ein Frontalangriff auf Heinrichs IV. weltliche Herrschaft. Als geradezu ungeheuerlich muss er den universalen Anspruch des Papstes aufnehmen, den „Kaiser absetzen und die Untertanen von ihrem Treueschwur entbinden“ zu können. Das kann sich er auf keinen Fall gefallen lassen. Wer ihn absetzen und seine Untertanen vom Treueschwur befreien kann, ist mächtiger als er selbst und legt obendrein Hand an die Grundlagen der Reichsordnung! Für Heinrich IV. ist sofort klar, wohin die Reise gehen soll – nämlich in die Unterordnung des Königtums unter die Macht des Vatikans.
Heinrich IV.
Heinrich IV. bekommt die Auswirkungen dieses päpstlichen Griffs nach der Macht unmittelbar zu spüren. Als er in Mailand und im Kirchenstaat Bischöfe einsetzten will, provoziert er den Papst und der Konflikt eskaliert innerhalb kurzer Zeit. Im Dezember desselben Jahres bedroht Gregor VII. den König mit dem Kirchenbann. Damit fordert er nicht nur Heinrich IV. heraus, sondern er wirft jenen Glaubensbrüdern im deutschen Episkopat den Fehdehandschuh auf den Tisch, die sich mit dem geistlich-weltlichen System von Geben und Nehmen bestens arrangiert haben. Die deutschen Kirchenmänner verstehen die Zeichen aus Rom sofort. Da sich die meisten von ihnen mit dem Reichskirchensystem arrangiert haben, würde die Durchsetzung der päpstlichen Ideen ihren Lebensstil erheblich verschlechtern. Deshalb kündigen zahlreiche Bischöfe am 10. Januar 1076 bei der Synode in Worms dem Papst den Gehorsam auf. Sie richten ein Schreiben an den „falschen Mönch Hildebrand“ und fordern diesen auf, den Stuhl Petri unverzüglich zu verlassen. Jener nahezu vergnüglich zu lesende Brief ist uns überliefert in der „Weltchronik“ des Abtes Ekkehard von Aura (1085 - 1125) und nimmt Bezug auf die Umstände der Papstwahl Gregors VII. am 30. Juni 1073, die, wie man lesen kann, keineswegs vergessen sind:
„Als du dich in die Leitung der Kirche eindrängtest, waren wir uns zwar darüber klar, welches verbotenen und frevelhaften Unterfangens gegen Recht und Gerechtigkeit du dich mit der dir eigenen Anmaßung erfrechtest, doch glaubten wir stillschweigend über deinen schlimmen Amtsantritt in der Hoffnung hinweggehen zu sollen, dass der so verbrecherische Anfang im Lauf einer tüchtigen und Eifer vollen Regierung ausgeglichen werden könnte. (…) Du hast durch bittere Spaltungen die Brandfackel der Zwietracht in die römische Kirche hineingeworfen und hast diesen Brand mit deinem rasenden Wahnsinn durch alle Kirchen Italiens, Deutschlands, Frankreichs und Spaniens auflohen lassen, indem du ruchlose Neuerungen einzuführen bestrebt bist und dich in unerhörter Überhebung aufblähst. (…) und so ging durch deine berühmten Erlasse – nur unter Tränen kann man davon sprechen – Christi Namen fast zugrunde. (…) Weil wir dies schlimmste der Übel nicht mehr länger dulden wollen, so fassten wir in gemeinsamer Berufung den einmütigen Beschluss, dir kundzutun, was wir bislang verschwiegen haben. Du kannst darum weder jetzt dem Apostolischen Stuhl vorstehen, noch wirst Du dies je können. (…) Nachdem du deinen Lebenswandel durch so vielerlei Schmach und Schande entehrt hast, werden wir (…) künftig nicht gehorchen, und weil, wie du öffentlich erklärt hast, keiner von uns für dich Bischof war, so wirst auch du für keinen von uns von nun ab Papst sein.“
Das ist natürlich starker Tobak. Der Zorn des deutschen Episkopats über die vielen Neuerungen, die der Papst gegen ihren Willen durchsetzen will, spricht Bände. Und ihr Brief hat Folgen! Denn nach der Lektüre des Schreibens ergreift der Papst die nächste Stufe der Eskalation und erklärt den König gemäß des 12. Satzes seines „dictatus papae“ für abgesetzt und exkommuniziert. Damit ist etwas für die mittelalterliche Welt Unerhörtes geschehen. Denn noch nie hat sich ein Papst so unmissverständlich in die Belange der weltlichen Herrschaft eingemischt, noch nie hat ein Papst öffentlich einen weltlichen Herrscher so degradiert und gedemütigt und ihn auch noch aus der Kirche geworfen. Mehr noch: Noch nie hat ein Papst so unüberhörbar zum Ausdruck gebracht, dass die geistliche über der weltlichen Macht zu stehen habe - und nicht umgekehrt. Der Streit mit dem Papst zeigt Wirkung: Einige Fürsten in Sachsen und Süddeutschland sowie ein Teil der Bischöfe nutzen die Gunst der Stunde und fallen von Heinrich VI. ab. Die Fürstenopposition – unter ihnen Welf von Bayern (1030 – 1101), Rudolf von Rheinfelden (1025 – 1080) und Berthold von Kärnten (1000 – 1078) - wittern eine Möglichkeit, sich selbst ins Spiel zu bringen und fordern den König auf, binnen „Jahr und Tag“, also in den nächsten zwölf Monaten, die Aufhebung des päpstlichen Bannes zu erreichen. Andernfalls müsse ein neuer König gewählt werden.
Читать дальше