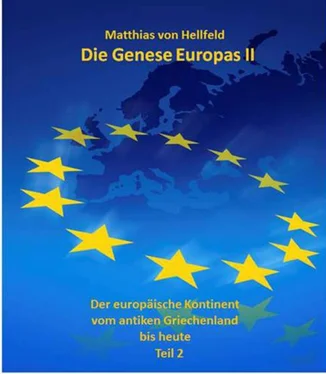Nun aber hat Gott den Kaiser mit seinem gewaltigen Heer ausgerechnet in einer Schlacht gegen die Feinde der Christenheit im Stich gelassen. Aber warum ist der Kaiser von Gott verlassen worden? Keine einzige zeitnahe Quelle hat sich getraut, das Ausbleiben der göttlichen Hilfe in der Schlacht von Cotrone zu thematisieren. Dafür hat sich ein vielsagendes, vielleicht sogar entsetztes Schweigen ausgebreitet. Die Herzöge in Ostfranken sind erschüttert darüber, dass sich Otto II. nach den beiden Niederlagen nicht etwa nach Hause begibt, sondern mehrere Monate in Rom bleibt, wo er nach einer Malariainfektion mit nur 28 Jahren verstirbt.
Diese Nachricht hat nicht nur Trauer in der Verwandtschaft ausgelöst, sondern auch Angriffslust bei den slawischen Stämmen östlich der Elbe. Der Aufstand des Lutizenbundes umfasst die zwischen Elbe, Oder und Ostsee lebenden westslawischen Stämme der Obodriten und Liutizen, die nun eine gute Chance sehen, sich von den sächsischen Eroberern zu befreien. Das Bistum Oldenburg, die Stadt Hamburg geraten in Mitleidenschaft, auch Brandenburg wird überfallen. Das alles hat langfristige Folgen, denn erst zwei Jahrhunderte später können die von den Slawen ruinierten Bistümer wieder aufgesucht werden. Die frommen Christenmenschen registrieren die Auflehnung östlich der Elbe und die Dimension des Aufstands, sie beklagen die hohen Verluste an Menschenleben und die Brutalität, mit der die Slawen gekämpft haben. Damit ist der Erfolg der christlichen Missionspolitik, wie sie seit Otto „dem Großen“ praktiziert worden ist, zunichtegemacht. In kürzester Zeit, so lautet die Klage, ist das Missions- und Ordnungswerk Ottos I. vernichtet. Mit wenigen Ausnahmen ist das Gebiet der Slawen für lange Zeit jeglicher Christianisierung verschlossen geblieben.
Aber der Misserfolg Ottos II. und die entsprechenden Konsequenzen bei den ostfränkischen Herzögen und Fürsten macht auf ein Problem aufmerksam, das in den kommenden Jahrhunderten immer wieder sichtbar wird. Je länger und je häufiger der Kaiser des Römischen Reichs in Italien sein muss, desto heftiger treten - mitunter jedenfalls - die Probleme im ostfränkischen Kerngebiet seiner Herrschaft hervor. Das gilt auch für Otto III., der 996 in Rom von Papst Gregor V. (972 – 999) zum Kaiser gekrönt wird. Aber das geistlich – weltliche Gespann wird keine 12 Monate später auseinandergerissen, als Gregor V. einer Intrige zum Opfer fällt und von einem Gegenpapst gestürzt wird. Daraufhin muss Otto III. in Rom einmarschieren, um den in seinen Augen legitimen Papst erst auf die Beine und dann auch wieder auf den Heiligen Stuhl zu helfen. Offenbar ist er bei dieser Gelegenheit so angetan von Rom und seiner prunkvollen Schönheit, dass er der Idee verfällt, dort eine Kaiserpfalz zu errichten.
„Renovatio Imperii Romani“
Für Otto III. wird Rom zum Mittelpunkt seines Weltbildes. Von Rom aus will er das Reich regieren. Hier soll das künftige Zentrum der von ihm vereinigten geistlichen und der weltlichen Macht errichtet werden. Die „renovatio imperii Romani“ („Wiederherstellung des Römischen Reiches“) soll durch ihn ins Werk gesetzt werden, so jedenfalls hat es sich der Kaiser fernab der Heimat gedacht.
Otto III. hat aber noch weitergehende Ambitionen und will – ebenso wie der Papst – als irdischer Vertreter des Apostelfürsten gelten und sich als „servus apostolorum“ („Diener der Apostel“) ansprechen lassen. Damit beansprucht er das oberste Verfügungsrecht über den Kirchenstaat und macht deutlich, dass er sich als Nachfolger eines römischen Kaisers aus der Blütezeit des untergegangenen Römischen Reiches sieht. Ein solcher römischer Kaiser hat tatsächlich die gesamte Macht über das „Imperium Romanum“ gehabt, das sich – etwa zur Zeit Caesars - von Spanien und Frankreich über die Alpen nach Italien erstreckt und sowohl Griechenland, Kleinasien bis Byzanz und Damaskus als auch weite Teile der afrikanischen Küste umfasst hat.
Otto III. meint es Ernst und will sein Weltbild in die politische Tat umsetzen. Aber sein Tod im Jahr 1002 hat die Realisierung seiner Vorstellungen beendet, bevor er richtig damit angefangen hat. Die Zeitgenossen Ottos III. stehen seinem politischen Treiben skeptisch und ablehnend gegenüber, wie der Bericht des sächsischen Erzbischofs und Missionars Brun von Querfurt (ca. 970 – 1009) deutlich macht. Jener Brun von Querfurt hat Otto III. gut gekannt und ihn als Domherr und Hofkaplan oft nach Rom begleitet. Kurz nach dessen Tod verfasst er eine kaum deutlicher zu formulierende Kritik am Kaiser:
„Hat er auch sonst viel Gutes getan, so war er doch in einem Punkte im Irrtum. (…) denn da ihm Rom allein gefiel und er das römische Volk vor allen anderen durch Geldgeschenke und Ehren auszeichnete, wollte er für immer in Rom verweilen (…) Dies war die Sünde des Königs: Das Land seiner Geburt, das liebe Deutschland, wollte er nicht einmal mehr sehen, so groß war die Sehnsucht, in Italien zu bleiben. (…) Der gute Kaiser befand sich nicht auf dem rechten Wege, (…) denn wenn auch die Bürger (Roms) seine Wohltaten nur mit Bösem vergolten hatten, so war doch Rom der von Gott den Aposteln gegebene Sitz. Und selbst da brach die Liebe zu seinem Geburtslande, dem Sehnsucht weckenden Deutschland, nicht in ihm durch; das Land des Romulus, vom Blute seiner lieben Getreuen durchtränkt, gefiel in seiner buhlerischen Schönheit dem Kaiser immer noch mehr …“
Man erkennt in dieser Kritik das grundsätzliche Dilemma vor dem die deutschen Kaiser stehen: Die Italienpolitik wird nicht nur viel Energie und Zeit, sondern auch immensen finanziellen Aufwendungen erfordern. Bis ins hohe Mittelalter werden sie immer wieder gezwungen sein, mit Streitkräften nach Italien zu ziehen und die politischen Ränkespiele ihrer Tage zu ordnen. Das wird ihr Interesse von dem Teil des Reiches ablenken, dem sie eigentlich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit hätten zukommen lassen sollen: Dem deutschen Reich.
Aus dem einen Teil des Vielvölkerstaats von Karl „dem Großen“ ist in der östlichen Hälfte ein eigener Vielvölkerstaat geworden, der sich in der Zukunft als ein kompliziertes geostrategisches Gebilde erweist, das schwer regierbar ist. Das deutsche Reich wird durch Zugewinne zwar immer größer und der deutsche Kaiser ist zeitweise der mächtigste Herrscher in Europa. Aber die politischen Möglichkeiten, das Reich zusammen zu halten, wachsen nicht in gleichem Maße. Die militärische Herrschaft über Italien ist schwer zu stabilisieren und die Zentralmacht muss weite Teile ihres Einflusses an die immer stärker werdenden Fürsten und Herzöge abtreten. Diese Vorschau betrifft den östlichen Teil des alten Frankenreichs, im Westen sind die Erschütterungen nicht so spürbar, weil dort das Verhältnis zwischen der zentralen Macht und den Partikularmächten zu Gunsten der Zentrale entschieden wird.
Im westfränkischen Reich haben die Könige dafür gesorgt, dass die nach Unabhängigkeit und Einfluss strebenden Territorialfürsten sich der Zentralgewalt unterordnen. Dieser Prozess ist vor allem dadurch befördert worden, weil seit 987 die Kapetinger auf dem Thron sitzen und für die Einigung des Landes und die Festigung ihres Königtums sorgen. Sichtbarster Ausdruck der gegenläufigen Entwicklung in Westfranken ist der Auf- und Ausbau einer Regierungsstadt – nämlich Paris. Die westfränkischen Könige herrschen in einem Palast auf der Ile de la Cité, der ursprünglich von den römischen Besatzern gebaut worden ist. Eine Herausforderung für den Zusammenhalt des westfränkischen Reichs sind im die im Norden einfallenden Normannen gewesen. Seit 900 siedeln sie in der „Normandie“ und bekommen 911 das Land als Lehen zugesprochen. Die Normannen sollen in den westfränkischen Staat eingebunden werden und gleichzeitig die offene Kanalküste gegen weitere Überfälle schützen. Ohne es mit einem konkreten Datum belegen zu können, sprechen Forscher seit etwa diesem Zeitpunkt nicht mehr vom westfränkischen Reich, sondern von Frankreich.
Читать дальше