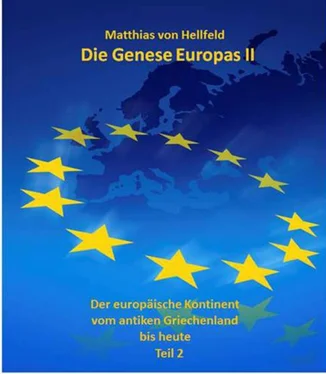Im März 953 bricht der Aufstand des frustrierten Sohnes Liudolf aus. Zunächst scheint es so, als könnte die Rebellion klappen. Als Otto hört, dass Mainz in die Hände seiner Feinde gefallen ist, beginnt er im Sommer 953 mit der Belagerung der Stadt. Aber der Konflikt ist militärisch nicht zu lösen gewesen, sodass der Streit auf dem Verhandlungswege beigelegt werden muss. Nicht nur der Aufstand seines Sohnes und die Bedrohung durch die Hunnen schwächt zeitweise die Herrschaft Ottos. Innerhalb von zwei Jahren sterben eine Reihe wichtiger politischer Akteure, so dass Otto I. ständig gezwungen ist, die Machtbalance im ostfränkischen Reich neu zu justieren. An neuerlichen Turbulenzen in Italien dürfte er in diesen Jahren sicher kein Interesse gehabt haben, aber sie bleiben nicht aus.
Angriff auf das „Patrimonium Petri“
Denn ein weiterer Sohn Berengars II. – namens Wido (949 – 965) – hat mittlerweile auch Gefallen an der Macht gefunden und 959 das Herzogtum Spoleto erobert. Das ist nicht irgendein Herzogtum gewesen: Spoleto grenzt im Süden an den Kirchenstaat und eignet sich bestens zum Angriff auf das „patrimonium petri“. Angesichts des kriegslüsternen Wido und des nicht minder entschlossenen Berengar II. fühlt sich Papst Johannes XII. in Rom in seiner Haut nicht mehr wohl. Die Lage wird immer prekärer, als Berengar II. von Ivrea eine schwere Krankheit Ottos und die Reichskrise durch den Aufstand seines Sohnes Liudolf ausnutzt, um seine Macht in Oberitalien weiter auszubauen. Im September 957 stirbt Liudolf während einer Mission im Auftrag seines Vaters in Oberitalien, was Berengar weiter in Richtung Kirchenstaat vordringen lässt. In dieser heiklen Situation ersucht Johannes XII. den ostfränkischen König um Hilfe. Genau wie rund 160 Jahre zuvor Karl „der Große“ leistet nun Otto I. dieser Bitte im Herbst 960 Folge.
Der Zug nach Rom wird akribisch vorbereitet. Für den Fall seines Todes lässt er auf einem Hoftag zu Worms seinen noch minderjährigen Sohn Otto II. zum Mitregenten krönen. Pfingsten 961 huldigen ihm die höchsten kirchlichen Würdenträgern des Landes. Aber all das kann über das Risiko eines Italienzuges nicht hinwegtäuschen, denn die praktische Herrschaft ist an seine Anwesenheit geknüpft. Er hat alle wesentlichen Funktionen des Landes auf sich und seine Verwandten bezogen. Das hat gut funktioniert, so lange er selber im Lande gewesen ist. Jetzt muss sich erweisen, ob Netz der Verwandten, Freunde und Getreuen, mit dem er das Land überzogen hat, halten wird.
Der Feldzug nach Italien beginnt im August 961 mit der beschwerlichen Überquerung der Alpen über den Brenner. Weihnachten ist das Heer bei Pavia. Als Berengars Gefolgsleute die Übermacht Ottos erkennen, weigern sie sich zu kämpfen. Otto erklärt den geflohenen Berengar für abgesetzt. Der entmachtete Berengar verschanzt sich auf einer seiner Festungen, wo er sich zwei Jahre später ergeben muss. In einer für ihn demütigenden Zeremonie unterwirft er sich Otto I., in dem er vor ihm kniend sein Schwert übergibt. Anschließend wird er in Bamberg ins Gefängnis gesteckt, wo er bis zu seinem Tod 966 auch bleibt. Otto hingegen zieht weiter nach Rom.
Kaiserkrönung Ottos I.
Am 1. Februar 962 empfängt ihn Johannes XII. freudig vor den Toren der Stadt und krönt ihn am nächsten Tag als Dank für die rasche Hilfe zum Kaiser des „Römischen Reichs“. Auch seine Frau Adelheid wird gesalbt und gekrönt und erhält so den gleichen Rang wie Otto. Das ist etwas Neues, denn bis dahin ist noch keine Frau eines Königs oder Kaisers mit gesalbt und gleichsam inthronisiert worden. Für das kaiserliche Paar bedeutet die gemeinsame Krönung auch ein gemeinsamer Besitz – nämlich Italien, zumindest der von Arabern nicht besetzte Teil Italiens.
Nach Karl „dem Großen“ ist nun der Sachse Otto I. der zweite Kaiser des Heiligen Römischen Reichs nach dem Untergang des Imperium Romanum 476. Am Tag nach der Krönung erfolgt die Gegenleistung des frisch gekürten römisch-deutschen Kaisers: In einer Prunkurkunde in Goldschrift auf purpurgefärbtem Pergament erneuert Otto den Pakt, mit dem schon Karl „der Große“ den Stellvertretern Christi auf Erden die Besitzungen des „Patrimonium Petri“ bestätigt hat.
Aber sein „Privilegium Ottonianum“ spricht dem Papst weitere Gebiete zu, die bis dahin zum Königreich Italien gehört haben. Da Otto I. aber seit der Heirat mit Adelheid König eben dieses italienischen Reichs ist, kann er leichten Herzens die Gebietsabtretungen beurkunden. Ferner hält die Urkunde fest, dass es in Zukunft keine Papstwahl geben werde, ohne dass der Kandidat Otto oder einem seiner Nachfolger vorgestellt worden ist. Man könnte also sagen, ein Pakt auf Gegenseitigkeit oder eine win-win-Situation: Otto ist römisch-deutscher Kaiser geworden, der Papst hat die Erneuerung der karolingischen Schenkung und noch ein bisschen mehr sowie den Schutz der weltlichen Macht bekommen.
„Renovatio Imperii“
Otto „der Große“ ist der erste in der langen Liste der „römisch-deutschen Kaiser“. Karl „der Große“ ist zwar auch Kaiser gewesen - aber ein fränkischer. Karl hat bei seiner Kaiserkrönung das fränkische Gesamtreich repräsentiert, Otto I. „nur“ den östlichen, später deutschen Teil. Die Bezeichnung „römisch-deutsch“ hat sich in der Forschung etabliert, um eine Unterscheidung zwischen den Kaisern der römischen Antike einerseits und den deutschen Kaisern der späteren Jahrhunderte andererseits zu haben. Kurze Zeit nach Otto wird aus dem „Ostfrankenreich“ ein „Regnum teutonicum“ oder ein „Regnum Teutonicorum“ – also ein „Königreich der Deutschen“.
Wie bei der Kaiserkrönung Karls „des Großen“ rund 160 Jahre zuvor spielt auch bei Otto I. die politische Theorie jener Jahre eine große Rolle. Nach dem oströmischen Kaiser Justinian I., der 534 versucht hat, das Römische Reich zurückzuerobern („Restauratio Imperii“ – also „Wiederherstellung des Reiches“), und Karl „dem Großen“, der 800 zum Römischen Kaiser gekrönt worden ist („Translatio Imperii“ – also „Übertragung des Reiches“), geht es nun ein drittes Mal um die Nachfolge des Imperium Romanum. Grundlage ist wieder die Theorie der vier Reiche (Babylonisches, Persisches, Griechisches und Römisches Reich) und die Vorstellung, dass mit dem Untergang des vierten Reiches das Ende der Welt gekommen sei. Mit der Krönung Karls „des Großen“ durch Papst Leo III. im Jahr 800 sei auch die Kaiserwürde des alten römischen Reiches auf den Franken übertragen worden. Otto I. führt nun eine „Renovatio Imperii“, also eine „Wiederbelebung des Imperiums“ durch.
Nach der so genannten „Translatio“, also „Übertragung“ an Karl „den Großen“, wird bei der Kaiserkrönung des Jahres 962 dieser Vorgang wiederholt, erneuert und ergänzt, denn Kaiser Otto will das Imperium „wiederbeleben“. „Übertragung“ und „Wiederbelebung“ sind die beiden ideologischen Begriffe, mit denen Otto I. sein hohes Amt begründet. Seine Kaiserwürde liegt in der direkten Tradition des römischen Kaisertums und als römischer Kaiser steht Otto I. an der weltlichen Spitze der „christianitas“ – der Christenheit. Otto I. ist der Bewahrer und Beschützer eines mittelalterlichen Imperiums, das innerhalb von etwas mehr als 400 Jahren dreimal in einem symbolischen Akt mit der römischen Antike verbunden worden ist: 534 durch Justinian I. mit der „Restauratio“, 800 mit der „Translatio“ und eben jetzt 962 mit der „Renovatio“ des Imperium Romanum.
Christliche Herrschaft
Otto ist ein durch und durch christlicher Herrscher. Er ist vollkommen verwoben mit der Vorstellung, dass seine weltliche Macht von Gott gegeben sei und dass er dessen Reich auf Erden zu verteidigen habe. Das durch die zweite Kaiserkrönung erneuerte Verhältnis zwischen Papst und Kaiser passt zudem in das Weltbild des 10. Jahrhunderts. Darin ist der Papst der alleinige Interpret der göttlichen Vorstellungen, der durch die Auslegung der Heiligen Schrift den göttlichen Willen vermittelt. Der Kaiser herrscht von Gottes Gnaden und mit päpstlichem Segen, um in einer gewalttätigen Welt für Ordnung zu sorgen. Der Papst, als Vertreter der geistlichen Welt und sein weltliches Pendant, der Kaiser, stellen eine Symbiose dar. Beide sind im Verständnis der Zeitgenossen Figuren einer von Gott gewollten Weltordnung, der niemand entfliehen kann. Papst und Kaiser sind die Basis des „christlichen Abendlandes“. Für beide stehen Amt und Ansehen auf dem Spiel, falls sie diese „göttliche Ordnung“ zerstören würden.
Читать дальше