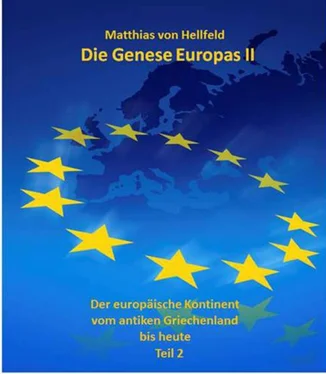Abgesehen vom Emirat von Cordoba ist über ganz Europa das Christentum verbreitet. Seit die christliche Religion durch das Dekret des oströmischen Kaisers Theodosius I. (347 – 395) vom 27. Februar 380 zur Staatsreligion im gesamten damaligen Römischen Reich geworden ist, steht die junge Religion unter Staatsschutz und kann sich dementsprechend schnell ausbreiten. In den kontinentaleuropäischen Ländern ist das Christentum seitdem durch die strengen Vorgaben des Vatikans geprägt. Im östlichen, slawisch geprägten Gebiet ist die Form der Religionsausübung durch dort vorherrschende Traditionen geformt worden.
Am Weihnachtstag 800 ist Karl „der Große“ (747 – 814), der König der Franken, durch Papst Leo III. (750 – 816) zum römischen Kaiser gekrönt worden. Karl glaubt an die Theorie der „Translatio Imperii“ - also an die „Übertragung des Imperium Romanum“ an ihn und seine Nachfolger. Damit – so die Begründung dieser politischen Theorie, die sich auf die Bibel beruft – sei die Welt vor dem Untergang gefeit, der nach dem Ende der vier Reiche der Ägypter, der Perser, der Griechen und eben der Römer drohe. Mit der Übertragung an ihn, ist das römische Reich nicht untergegangen, sondern lebt in ihm und seinem Reich weiter. Da Karl den Cäsaren des Imperium Romanum nachfolgt, übernimmt er auch deren politische Hinterlassenschaften, zu denen das zur Staatsreligion erhobene Christentum gehört. Konsequenter Weise ist das Christentum auch Staatsreligion im Frankenreich. Da der Papst den Frankenkönig zum römischen Kaiser gekrönt hat und die Regentschaft mit göttlichem Segen versehen hat, sind beide eine Symbiose eingegangen: Der Papst versieht die Kaiserkrone mit seinem Segen, der Kaiser stellt den Kirchenstaat und das Christentum unter den Schutz seiner weltlichen Macht.
Das Christentum breitet sich aus und mit dieser Expansion kommt auch der Absolutheitsanspruch der christlichen Kirche über den europäischen Kontinent. Mit der Krönung Karls zum römischen Kaiser steht der Papst unter weltlichem Schutz, seine päpstliche Interpretation der Bibel prägt die gesamte damals bekannte, nichtislamische Welt. Von Rom aus steuern die Päpste fortan das religiöse Leben in Europa und können allmählich auch Einfluss auf die Politik nehmen.
Pornokratie
Aber das Papsttum im frühen Mittelalter ist nicht nur der Mittelpunkt der christlichen Welt, sondern erliegt zeitweise auch weltlichen Verlockungen. Zwischen 904 und 963 verkommen die Papstwahlen zu einer Farce, da sie den politischen Ränkespielen ihrer Zeit geopfert werden. Zudem hat der Vatikan in jenen Jahren offenbar unter dem unguten Einfluss eines Mutter-Tochter-Gespanns gestanden, dem es beinahe gelungen wäre, den Vatikan in ein päpstliches Freudenhaus zu verwandeln. Jedenfalls verwendet der renommierte Kirchenhistoriker Cesare Baronius (1538 – 1607) in seinem 1603 erschienenen Werk für diese Epoche den Begriff „Pornokratie“. Ein weiterer Zeuge der Zustände ist der Historiker und Bischof von Cremona, Liutprand von Cremona (920 – 972). Wie korrekt diese erstaunliche Bezeichnung ist, verrät ein Blick in die Annalen der römischen Kurie. In den Augen der Chronisten wird der Vatikan in dieser Zeit tatsächlich von einem Hurengespann geleitet. Es handelt sich um ein Frauen-Tandem, Theodora (894 – 950) und Marozia (890 – 937), die beide Mätressen diverser Päpste sind.
Die Geschichte des Papsttums gleicht in diesen Jahren einer Räuberpistole. Besonders hemmungslos wird der christliche Kodex unter Sergius III. (850 - 911) mit Füßen getreten. 904 inszeniert er mit dem Ehemann seiner Mätresse Marozia, Herzog Alberich I. von Spoleto (889 – 925) einen Marsch auf Rom und lässt sich anschließend unter dem militärischen Schutz des Herzogs zum Papst weihen. Diesem ziemlich merkwürdigen Machtgebaren folgt ein Blutrausch, dem seine beiden Vorgänger und zwei christliche Mitbrüder zum Opfer fallen. Kommentatoren dieser Zeit bezichtigen den Stellvertreter Christi auf Erden, „ständig grenzenlose Abscheulichkeiten mit leichten Frauen“ zu begehen, womit sie nicht nur Sex mit Minderjährigen gemeint haben. Sergius III. ist offenbar „ein Sklave eines jeden Lasters und ein äußerst gottloser Mensch“, heißt es in den Überlieferungen weiter.
Im Mai 946 wird mit Johannes XII. (939 – 964) ein Sohn Alberichs I. auf dem Heiligen Stuhl platziert. Er trägt den Beinamen „der Schlechte“ und das nicht zu Unrecht. Denn Papst Johannes XII. ist Atheist, hat jede Menge Geliebte beiderlei Geschlechts, mit denen er geradezu unglaubliche Orgien im Vatikan feiert. Der für seine papstkritischen Bemerkungen bekannte zeitgenössische Chronist Liutprand von Cremona berichtet nicht nur von einem Bordell im Vatikan, sondern auch noch von Mordanschlägen, Inzest, Simonie und einer Jagd- und Spielleidenschaft des Papstes, so dass der Vorwurf der permanenten Gotteslästerung nicht weiter ins Gewicht fällt. Sein Verhalten ist derart skandalös, dass ihm der Prozess gemacht werden soll. Die förmliche Anklage liest sich so:
„Wisset denn, nicht wenige, sondern alle, sowohl Weltliche als auch Geistliche, haben Euch angeklagt des Mordes, des Meineids, der Tempelschändung, der Blutschande mit Eurer eigener Verwandten und mit zwei Schwestern. Sie erklären noch anderes, wovor das Ohr sich sträubt, dass Ihr dem Teufel zugetrunken und beim Würfeln Zeus, Venus und andere Dämonen angerufen habt.“
Über den Tod von Johannes XII. gibt es unterschiedliche Berichte. Vermutlich ist der Papst während eines Geschlechtsaktes mit einer verheirateten Römerin von deren Ehemann überrascht und mit mehreren wilden Hammerschlägen aus dem Leben befördert worden. Eine Synode hat ihn 991 zu Recht „ein Ungeheuer ohne jede Tugend“ genannt.
Italienische Verhältnisse
Zweifellos sind diese knapp 60 Jahre des Papsttums kaum mehr als die Geschichte einer kriminellen Vereinigung gewesen. Der christliche Kodex ist mit Füßen getreten worden und nicht wenige Päpste in dieser Zeit haben ihren weltlichen Lastern ausgiebiger gefrönt als sie sich mit der Verbreitung der christlichen Lehre beschäftigt haben. Mit der Absetzung von Papst Johannes XII. hat diese beschämende Periode ein Ende gefunden.
Gleichzeitig wird in diesen Jahren auch ein anderer Konflikt deutlich. Denn die Päpste stehen unter zunehmendem Druck einiger mächtiger oberitalienischer Familien, die mehr Einfluss fordern, Gebietsansprüche stellen und mit dem Papstamt liebäugeln. Eine dieser Familien wird von Berengar II. von Ivrea (900 – 966) angeführt, der den Kirchenstaat dauerhaften Attacken aussetzt. Berengar II. will sich den Kirchenstaat einverleiben und – wenn es geht - auch noch den Rest von Italien. Berengar II. ist Nachfahre Karls „des Großen“ und Markgraf von Ivrea, dessen Hausmacht im Norden Italiens in der Nähe von Mailand und Turin liegt. Neben dem Papst hat Berengar II. mit dem italienischen König Hugo I. von Arles (887 – 947) noch einen weiteren Gegner.
Für den Papst ist das eine schwierige Lage, denn er hat weder eigene militärische Möglichkeiten, noch kann er auf Nachbarn hoffen, die ihm zu Hilfe eilen. Deshalb entsinnt sich Johannes XII. wie sein Vorgänger Leo III. vor 150 Jahren eines starken weltlichen Herrschers, der ihm in dieser bedrohlichen Situation helfen könnte. Damals sind es die kampferprobten Langobarden gewesen, die Leo III. das Leben schwer gemacht haben, nun sind es norditalienische Territorialherren, die Johannes XII. in Angst und Schrecken versetzen. Damals ist der Frankenkönig Karl zu Hilfe gekommen – nun soll es ein Sachse sein, der hilft, die italienischen Verhältnisse zu klären.
Heinrich I.
Mit Heinrich I. (876 – 936) sitzt im Jahr 919 der erste Sachse auf dem ostfränkischen Königsthron. Nachdem er 921 den Gegenkönig Arnulf von Bayern (ca. 870 – 937) unterworfen hat, ist seine Machtposition unumstritten. Heinrich I. steht vor schweren Problemen, als er sein Amt antritt, denn die Ungarn sind Anfang des neuen Jahrhunderts von den Petschenegen aus ihrer ursprünglichen Heimat an den nordwestlichen Ufern des Schwarzen Meeres vertrieben worden und haben sich bei der Suche nach neuen Siedlungsräumen in Richtung Kontinentaleuropa aufgemacht. Dabei stellen sie sich nicht zimperlich an. Die Beschreibungen ihrer Überfälle lassen jedenfalls an Grausamkeit nichts zu wünschen übrig. Raub- und Plünderungszüge führen die ungarischen Heere nach Mähren, Kärnten, Sachsen, Thüringen und schließlich nach Bayern bis zur Lech, deren Ufer mehrfach mit dem Blut erschlagener Soldaten getränkt werden.
Читать дальше