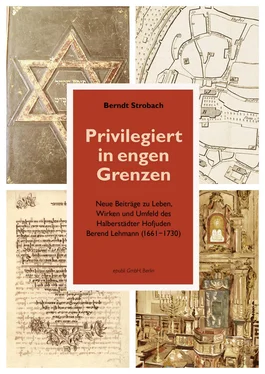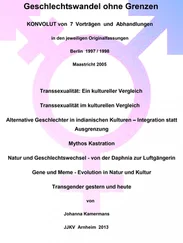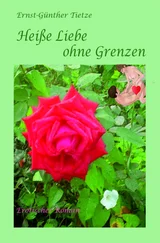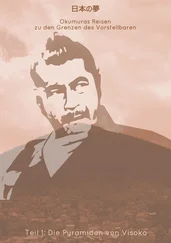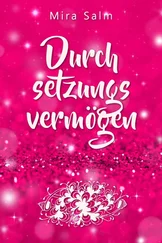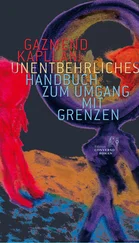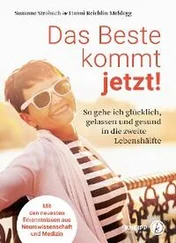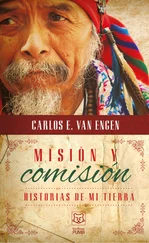1697 allerdings revoziert er (mitveranlasst durch einen umstrittenen Hauserwerb Berend Lehmanns) 117diese liberale Politik: Er verbietet den Juden Bau und Neukauf; sein Nachfolger, König Friedrich Wilhelm I. (1688–1740), erlaubt den Hauskauf nur mit spezieller Genehmigung für kurze Zeit, um ihn 1718 wieder zu untersagen. Die Verbote werden allerdings nicht strikt befolgt.
Lüdemann hat berechnet, dass die Wohndichte in Halberstadt mit nur 7 Personen pro jüdischem Haus sehr günstig war; in Frankfurt am Main lag sie zur selben Zeit (1699) bei bis zu 18 Personen pro Haus. 118
Der Höchstbestand an Judenhäusern in absoluten Zahlen wurde beim Regierungsantritt Friedrichs II. (des Großen, 1712–1786), im Jahre 1740, erreicht. Damals besaßen 176 jüdische Familien in Halberstadt 131 Häuser. Das war immer noch ein sehr günstiges Verhältnis von einem Haus pro 1 1/3 Familie, etwa im Vergleich zu Halle, wo 3½ Familien sich ein Haus teilen mußten. Nach dem repressiven Generalreglement Friedrichs des Großen von 1750 sollte gar nur jede fünfte jüdische Familie ein eigenes Haus besitzen dürfen. 119
Für Halberstadt typisch war übrigens während der gesamten Zeit der Anwesenheit von Juden in der Stadt, dass es kein ausgesprochenes Ghetto gab, sondern „Juden und Christen wohnten[...] durchmischt und nutzten nach Besitzerwechseln die gleichen Gebäude“; 120allerdings war im Voigteibezirk 121die jüdische Konzentration hoch, und zwar waren stellenweise zwischen 70 Prozent (Judenstraße) und 50 Prozent (Seidenbeutel) der Häuser in jüdischem Besitz. 122
In diesem Bereich befanden sich naturgemäß alle Immobilien der jüdischen Gemeinde und ebenso jene Häuser, die Berend Lehmann nacheinander oder gleichzeitig im Besitz hatte. Diese Häuser werden hier, um Missverständnisse zu vermeiden, mit Großbuchstaben von A bis X bezeichnet, die in einer Liste auf Seite 37 aufgeführt sind.
Lehmanns Anfänge in ‚Klein Venedig’: Bakenstraße 37, links
Im Gefolge von Auerbachs Geschichte wurde Berend Lehmann lange Zeit als geborener Halberstädter angesehen. Auerbach beruft sich auf die Erwähnung Juda Lehmann Halevys, des Vaters des Residenten, im Memorbuch: „Dieser überaus fromme und demüthige Mann beschäftigte sich hier [Hervorhebung: B.S.] stets mit Thorastudium und Wohlthätigkeit [...]“. Demnach nahm er an, dass schon der Vater aus Essen nach Halberstadt gekommen sei, wo dann auch die Geburt des Sohnes stattgefunden habe.
Demgegenüber stellte bereits 1913 der Essener Rabbiner Salomon Samuel fest, dass Juda Lehmann 1693 in Essen starb, wo seine Frau seit 1694 als Witwe geführt wurde. 123
Wenn man nicht annehmen will, dass er vorher vorübergehend in Halberstadt gelebt hat – was sich zum Beispiel in der Judenliste von 1669 hätte niederschlagen müssen 124und was bei den strengen Vergleitungsbestimmungen unwahrscheinlich ist –, dann hat das Memorbuch eine Legende transportiert, oder Auerbach hat den Memorbuch-Eintrag missverstanden.
Judas Sohn, Berend Lehmann, ist jedenfalls erst seit 1687, und zwar durch Leipziger Messelisten, als Halberstädter Einwohner nachweisbar. 125Nach der üblicherweise etwa alle zehn Jahre stattfindenden Zählung der in Halberstadt wohnenden Juden lebte er 1688 mit seiner Frau Miriam, geborene Joel, 126zur Miete bei Moyses Levin „unterm Rathe“ (vgl. Bd. 2 Abb. 2 und Dok. 3). Das war auf jeden Fall im neueren jüdischen Siedlungsgebiet, der Voigtei. Er besaß noch keinen eigenen brandenburgischen Schutzbrief, sondern galt als Familienanhang seines Schwiegervaters Joel Alexander. 127Die Lehmanns hatten noch keine Kinder, und der bescheidene Haushalt kam ohne Dienstboten aus. 128
Ein Jahr später ist er offenbar finanziell in der Lage, sich ein eigenes Haus zu bauen, und auf den Antrag für eine entsprechende Genehmigung wird von der kurfürstlichen Regierung ein „Decretum“ erlassen, nach dem er eine „wüste* Stelle zu bebauen“ habe. 129Das so 1690 entstandene Haus (Lehmann hat inzwischen einen eigenen Schutzbrief (vgl. Abb. 5 und 6) und arbeitet als Münzagent; [Dok. 4]) dürfte im Kern schon dasjenige gewesen sein, welches in der Judenhaustabelle von 1699 als „am waßer, ein Hauß unter des Ambtes der Majorey Jurisdiction gehörig“ 130bezeichnet wird und in dem er bis an sein Lebensende gewohnt hat, nämlich auf der nördlichen Hälfte des Grundstücks Bakenstraße 37 (Häuserliste Buchstabe A). Es lag in der Tat am Wasser, nämlich zwischen den Wasserläufen Holtemme und ihrem Nebenflüsschen Tintelene, die damals noch offen durch die Unterstadt flossen (die Gegend unterhalb der Peterstreppe wurde deshalb noch lange Zeit volkstümlich ,Klein Venedig‘ genannt).
[no image in epub file]
Abb. 5 (links): Auf der Schutzjudenliste von 1690 erscheint Berend Lehmann (linke Spalte, 7. Eintrag) zum ersten Mal als Inhaber eines eigenen Brandenburgischen Schutzbriefes.
Abb. 6 (rechts): Blatt mit den deutschen und den hebräischen Namen der Halberstädter Schutzjuden, vermutlich die Vorlage der jüdischen Gemeindevorsteher für die offizielle preußische Schutzjudenliste von 1691, Lehmann an 2. Stelle.
Nach der erwähnten Darstellung Auerbachs ist ja der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. 1692 „auf das unter lauter Baracken hervorragende stattliche Wohnhaus des Bermann [das ist Berend Lehmann]“ an der Peterstreppe aufmerksam geworden. 131
Aus den im vorigen Kapitel erwähnten Gründen kann man die rührende Auerbach-Anekdote unter ,Legenden’ verbuchen. Dass es schon zu so frühem Zeitpunkt in ,Klein Venedig’ ein „hervor-ragendes“, repräsentatives Steinhaus gegeben hat, dagegen spricht die Bemerkung in einem Dokument von 1698 132, der Erwerb eines anderen Hauses werde ihm deshalb erlaubt, „weil sein jetziges, worin Er wohnet, zu klein“ sei. Wenn mit diesem „jetzigen“ Bakenstraße 37 links gemeint war, so müsste es zunächst recht klein und erst nach 1690 erheblich vergrößert worden sein. So legt es auch der Vermerk in der Judenliste von 1699 nahe, „Berendt Lehmann“ habe 2 Häuser (das zweite wäre „Pott“ [ M ] oder „Heister-2 [ L ]“) 133mit insgesamt (nur) 5 Stuben für sich selbst, seine Frau, 4 Kinder und 5 Personen „Gesinde“. 134
Eindeutig als in seinem Besitz und von ihm bewohnt ist Bakenstraße 37 links ( A ) erst im Jahre 1707 nachweisbar, und zwar durch drei Bauzeichnungen, die sich im Berliner Geheimen Staatsarchiv erhalten haben (vgl. Abb. 17 und 18). 135
Danach und nach späteren Umbauplänen war es um diese Zeit schon – wie heute noch weitgehend existent (vgl. Abb. 21) – ein zweigeschossiges Gebäude, traufständig angeordnet, mit Walmdach. Das Erdgeschoss war zur Straße hin in Sandstein gemauert; auch durch eine repräsentative Außentreppe sowie durch ein Ochsenauge über dem Eingang hob sich das Haus im Zustand von 1707 in der Tat deutlich aus der bescheidenen Fachwerkumgebung heraus. Lüdemann betont die großzügige Raumaufteilung im Inneren und weist auf die (noch spätere) Größe von Lehmanns Haushalt hin. 136Er umfasste 1724 20 Personen. 137Zu diesem Zeitpunkt war allerdings das Haus schon zweimal erweitert worden. 138
| Liste der in Kapitel 2 besprochenen HäuserA „Klein Venedig“ (Bakenstraße 37) linke SeiteB „Klein Venedig“ (Bakenstraße 37) rechte SeiteC „Klein Venedig“ ehemals königliche MühleD „Schacht“, ex Heister-1, ex Lossow 1, Vorderhaus, Bakenstraße 28E „Schacht“ ex Heister-1, ex Lossow 1, Hinterhaus, 1699 neu, Bakenstraße 28F Gartenhaus an der Stadtmauer, neben „Schacht“- GartenG Vorgänger-Synagoge im Bereich der Gärten Bakenstraße 26/27H Judenstraße 24–27 Hinterhaus-Fachwerk-Synagoge, 1669 neuI Große Barock-Synagoge 1709/1712J Alter Klaus-Standort zwischen Juden- und BakenstraßeK Neuer Klaus-Standort, Rosenwinkel 18, ex Spital?L Lochow-2 = Heister-2 = 1699 Berend Lehmann, Bakenstraße 27M Pott = 1699 Berend Lehmann, Bakenstraße 26N Judenstraße Ostseite, 1706 Berend Lehmann, ex Levin Joel, baufälligO Judenstraße Ostseite, 1706 Berend Lehmann, ex Levin Joel, wüstP Judenstraße wo? 1732 Isaak Joel an Aaron AbrahamQ Judenstraße wo? 1736 Lehmann Behrend an Jacob Nathan Meyermöglicherweise identisch mit N/OR Gartenhaus im Garten an der großen Synagoge, 1734 subhastiertS Judenstraße Westseite (Nr. 27?): Ex Meyer Michael, 1699 an Judenschaft,Durchgang zur Vorgänger-Synagoge 2 ( H )T Judenstraße Westseite (Nr. 25?) 1699 Levin Joel, gegenüber N/OU Judenstraße 15/16, Ostseite, „Berend-Lehmann-Palais“V Judenstraße Westseite (Nr. 24?) 1699 David Israel, ex Salomon JonasW Judenstraße Westseite (Nr. 26) 1699 David Wulff, ex Wolf DavidX Judenstraße Westseite (Nr. 28?) 1699 Philipp Jost |
Wohnhilfe für arme Juden
Читать дальше