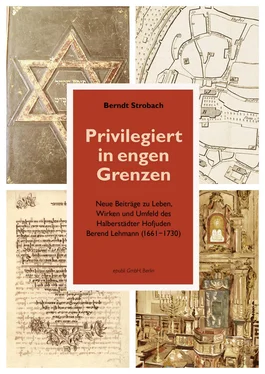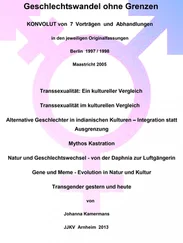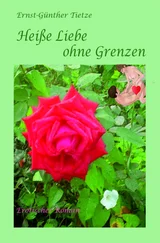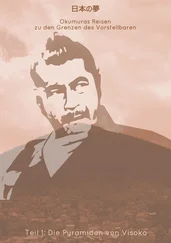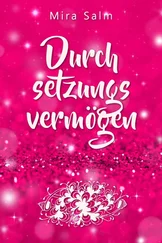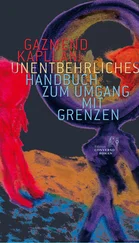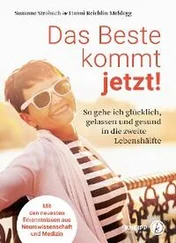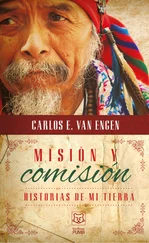1 ...8 9 10 12 13 14 ...23 53Sächsisches Hauptstaatsarchiv abgekürzt (SHSA) Dresden 10036, Geheimes Finanzarchiv, Loc.33761, Rep. XI.
54Laux, Stephan: Schnee, Heinrich, Dr. phil., online-Biographie im Internet auf www.lwl.org.
55Schnee, Heinrich: Die Hoffinanz und der moderne Staat (abgekürzt: Schnee, Hoffinanz), Bd. III, Die Institution des Hoffaktorentums in den geistlichen Staaten Norddeutschlands und an kleinen norddeutschen Fürstenhöfen, im System des absoluten Fürstenstaates, Berlin 1955, S. 251−253.
56Schnee, Hoffinanz, Bd. II: Die Institution des Hoffaktorentums in Hannover und Braunschweig, Sachsen und Anhalt, Mecklenburg, Hessen-Kassel und Hanau, Berlin 1954. S. 169ff. Vgl. besonders die Zusammenfassung S. 198.
57Ebd., S. 185.
58Ebd., S. 181.
59Ebd., S. 197.
60Ebd., S. 49.
61Ebd., S. 176.
62Saville, Pierre: Le Juif de Cour. Histoire du Résident royal Berend Lehman (1661-1730) (abgekürzt: Saville, Juif), Paris 1970.
63Laut E-Mail-Nachricht eines Großneffen von Pierre Saville, des Musikjournalisten Julien Petit, gegenüber Jutta Dick, der Direktorin der Halberstädter Moses Mendelssohn Akademie, vom 7.3.2008. In einem persönlichen Gespräch im Januar 2009 erfuhr Jutta Dick von Petit darüber hinaus, daß Saville/Schumann einer begüterten jüdischen Familie entstammte, und dass Petits und Schumann/Savilles Vorfahr Albert Lehmann im 19. Jahrhundert nach Frankreich eingewandert ist. Saville/Schumann war Privatgelehrter und Kunstsammler; er hat auch Dramen geschrieben. Laut Antiquitätenangeboten im Internet unter www.artfact.com wurden 2005 mehrere Kunstgegenstände aus einer „collection Robert Schumann et Pierre Saville“ versteigert. Hier erscheint er unter seinem Pseudonym neben seinem Bruder Robert Schumann, dem Großvater Julien Petits.
64Saville, Juif, S. 223.
65Ebd., S. XVIII, XXIII, XXIV.
66Ebd., S. XVIf.
67In: Meisl, Hof, S. 227–252.
68Vgl. ebd., S. 250, Fußnote 1.
69Ebd., S. 228 (Brotgetreide) und S. 229 (Konkursbetrug).
70Ebd., S. 28: „[...] les déductions qu’on peut tirer de certaines circonstances connues permettent d’apprendre que la nature lui avait donné des traits réguliers et agréables, une haute stature, un noble maintien.“
71Ebd., S. 192.
72Ebd., S. 154.
73Ebd., S. 171. Näheres über diese Einschätzung am Ende des 5. Kapitels dieser Arbeit.
74Lehmann, Manfred R.: On My Mind, New York 1996, S. 231.
75Ebd., S.110–113 „Assuring Perpetual Jewish Learning: The Halberstadt Archive of 1713−1847”.
76Lehmann, Manfred R.: Bernd Lehmann, Der König der Hofjuden, in: Hartmann, Werner (hg.), Juden in Halberstadt. Zu Geschichte, Ende und Spuren einer ausgelieferten Minderheit, Bd. 6, Halberstadt 1996, S. 6–12. Abgekürzt: Lehmann, M., König.
77Ebd., S. 7.
78Ebd., S. 7.
79Ebd., S. 8.
80Dies ist eine der Anekdoten über Lehmann, die noch der Überprüfung harren (beste Überlieferung in Schoeps, Hans-Joachim: Jüdisches in Berichten schwedischer Forscher, in: Gesammelte Schriften, Hildesheim/Zürich/New York 1998, Abt. I, Bd. 3, S. 188). Bei der Lektüre des Aufsatzes von Studemund-Halevy, Michael: „Es residieren in Hamburg Minister fremder Mächte“ in: Ries/Battenberg, Hofjuden, S. 159, fällt auf, dass dort exakt dieselbe Anekdote über den schwedischen Residenten in Hamburg, den reichen portugiesischen Juden Manuel Texeira, referiert wird. Eine Wanderlegende?
81Lehmann, M., König, S. 11. Das eingeklammerte Wort „jüdischen“ stammt möglicherweise vom Herausgeber, Werner Hartmann.
82Schmidt, Michael: Hofjude ohne Hof. Issachar Baermann-ben-Jehuda ha-Levi, sonst Berend Lehmann genannt, Hoffaktor in Halberstadt (1661−1730), in: Dick, Jutta/Sassenberg, Marina (Hg.): Wegweiser durch das jüdische Sachsen-Anhalt (Beiträge zur Geschichte der Juden in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, hg. Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien, Bd. 3) Potsdam, 1998, S. 202.
83Ebd., S. 202f.
84Dick, Jutta: Issachar Bermann Halevi – Berend Lehmann, ‚Gründungsvater’ der neuzeitlichen Jüdischen Gemeinde in Dresden, in: einst & jetzt – zur Geschichte der Dresdner Synagoge und ihrer Gemeinde, Dresden 2001, S. 42–56.
85Z.B. Lehmanns Geburtsort, (ebd. S. 42), Auflagenhöhe und Gestehungspreis des Talmud (S. 50), Brief in Archangelsk abgesandt (S. 44): In einem der von Meisl veröffentlichten Briefe (Leipzig, 6.12.1704, Meisl, Hof, S. 247) wird Archangelsk lediglich erwähnt als Ausgangsort von russischen Schiffen.
86Z.B. Traum des Vaters (53f.), Erschießung des Bären (S. 55).
87Mann/Cohen, Rothschilds, S. 206.
88Bürgelt, Cathleen: Der jüdische Hoffaktor Berend Lehmann und die Finanzierung der polnischen Königskrone für August den Starken, in: medaon Ausgabe 1/2007, S. 1−17. im Internet: www.medaon.de
89Raspe, Ruhm, S. 199.
90Vgl. Stern, Selma: Der Hofjude im Zeitalter des Absolutismus, Tübingen 2001, S. XIII. Die Verfasserin spricht von sich selbst in der dritten Person: „Zwei Welten in gleicher Weise verbunden, der jüdischen und der deutschen, empfand sie die Spannung, die ein solches Verhältnis erzeugt, nicht als unauflöslichen inneren Konflikt. Vielmehr sah sie in diesem doppelten Erbe eine Bereicherung ihres Daseins und eine Erweiterung ihres Lebensgefühls.“
91Poliakov spricht die Textsorte des Buches zutreffend an: „Le récit [die Erzählung] de P. Saville [...]“. Saville, Juif, S. 11.
92Vgl. den Artikel „Vereinigte Staaten von Amerika“ in: (hg.) Schoeps, Julius H.: Neues Lexikon des Judentums, S. 832, darin insbesondere die Angaben über die Zunahme von Mischehen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Partnern.
2. Kapitel
Lehmanns Wohnen und Bauen in seinem Halberstädter Umfeld
Halberstadts Juden zwischen Dreißigjährigem Krieg und friderizianischem Judenreglement
Nach den Pestpogromen des 14. und 15. Jahrhunderts hat es wohl auch in Halberstadt im Jahre 1493 eine systematische Vertreibung der seit etwa 1250 ständig dort anwesenden Juden gegeben. Aber schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts gab es wieder einzelne Juden in der Stadt. 93
Allerdings, so weiß der Halberstädter Chronist des 18. Jahrhunderts, Johann Henricus Lucanus (Vgl. Abb. 43 und Dok. 2) „[a]nno 1633 sind nur 4 Juden Familien hier gewesen [...]“, 94also wohl nicht mehr als 20 Personen. Hundertundvier Jahre später, im Jahre 1737, lebten in Halberstadt 197 Familien, die von den insgesamt 15 000 Reichstalern an jüdischen Schutzgeldern, die in Preußen abzuführen waren, 2 785 Taler aufbrachten; in Berlin lebten zur gleichen Zeit nur 180 Familien mit einem fiskalischen Ertrag von 2 610 Talern, in Frankfurt/Oder 60 Familien mit 720 Talern abzuführendem Schutzgeld. 95
In Einwohnerzahlen ausgedrückt: 1737 beherbergte Halberstadt 1 212 Juden, 96das waren etwa 10 Prozent der Halberstädter Bevölkerung.
Dieses erstaunliche Wachstum hat mehrere Gründe. Der erste ist die merkantilistisch orientierte Judenpolitk des Großen Kurfürsten (Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 1620–1688); er war „der beständigen Meinung, daß die Juden mit ihren Handlungen [ihrem Handel] Uns und dem Lande nicht schädlich, sondern nutzbar erscheinen“. 97Damit meinte er allerdings ausschließlich wohlhabende Juden, wie der Halberstädter Chronist es formuliert, „Hüner, welche güldene Eier legen.“ 98
Auch unter seinem Nachfolger Friedrich III. (1657 − 1713, ab 1701 Friedrich I., König „in Preußen“) wurden relativ großzügig Schutzbriefe erteilt. So wurden „die in Halberstadt wohnenden sämtlichen Judenfamilien“ nach Friedrichs Regierungsantritt am 24. Mai 1691 „in Schutz und Schirm“ übernommen. 99
Wichtig für das Wachstum der Gemeinde war auch die Möglichkeit der vergleiteten Juden, ihren Kindern Schutzbriefe zu verschaffen, sie „anzusetzen“ (so der Fachausdruck). Bis 1714 war das ohne Probleme für mehrere Kinder möglich. Danach konnte nur der Älteste den Schutzbrief direkt vom Vater erben, ein zweiter Sohn musste mindestens 1 000 Taler Vermögen nachweisen, ein dritter konnte noch bei 2 000 Talern Vermögen angesetzt werden; die Konzession kostete 50, beziehungsweise 100 Taler. Über die Töchter konnten fremde Juden als Schwiegersöhne mitangesetzt werden; auf diese Weise kam zum Beispiel der Essener Berend Lehmann zu seinem brandenburgischen Schutzbrief. 100
Читать дальше