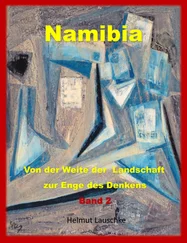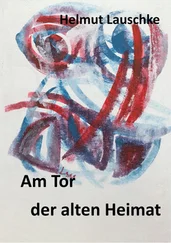Das wollte der junge eingebildete Arztpinsel in seiner geschniegelten Uniform nicht begreifen, und am wenigsten den Vorschlag, die intravenösen Spritzen an den Patienten selbst zu setzen und die Infusionen vor Operationsbeginn selbst anzulegen. Für das Mehr an Einsatz und Verständnis für die Saalprobleme hatte dieser blasierte Arzt kein offenes Ohr. Eine diesbezügliche Belehrung lehnte er nachdrücklich und unter allen Umständen ab, dass der Eindruck entstand, dass das Tragen der Leutnantsuniform der südafrikanischen Streitmacht mit dem Vorrecht verbunden ist, dem zivilen Superintendenten kategorisch zu widersprechen.
Das wollte sich Dr. Witthuhn nicht bieten lassen, denn von einer Kompromissbereitschaft gab es keine Spur. Dr. Hutman, dessen Jähzorn sich mit dem Blut im Gesicht staute, stand auf und machte sich durch die Bemerkung zum offiziellen Gegner, dass er sich beim Direktor beschweren werde, jenem Militäroberst, dessen zentrale Sorge sein persönliches Gebiss und die Zahnsanierung war. Der freche Arztkerl beschwerte sich, und die Beschwerde hatte Erfolg. Der neue Erlass ließ nicht lange auf sich warten, in dem geschrieben stand, dass das Pflegepersonal den Anweisungen des Arztes strikt zu folgen und wegen der permanenten Überlastung der Ärzte auch gewisse ärztliche Aufgaben in den Sälen auszuführen hätte. Gezeichnet war der Erlass von Dr. Eisenstein, Colonel and Director of Health & Welfare.
Mehr über die verzwickte Situation im Gesundheitswesen, das von Südafrika kontrolliert und verwaltet wurde, und über die regionale >Administration for Ovambos< sollte ich am ersten Abend im Hause von Dr. Witthuhn erfahren. Leon Witthuhn war Sohn eines deutschen Missionars und wurde in der Kap-Provinz geboren. Er war verheiratet und hatte drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Er sprach englisch, afrikaans und ein gutes Deutsch und lebte mit seiner Familie über ein Jahr in Deutschland, wo er als Arzt beim Luftwaffengeschwader >Richthofen< im Oldenburgischen tätig war.
“Kommen Sie, ich zeige Ihnen ihr Zimmer”, sagte er, und wir standen in einem engen, mit Kartons vollgestopften Raum, wo auf dem Bett Hemden, Hosen, Socken und andere Dinge neben Zeitschriften und beschriebenen und unbeschriebenen Blättern lagen. Die Luft in dem kleinen Raum war stickig, und die Mücken schwirrten herum. Das Fliegengitter am Fenster hatte Risse. Leon Witthuhn räumte mit wenigen Griffen die Sachen vom Bett und stapelte die vollen und halbvollen Kartons an der gegenüberliegenden Wand bis zur Decke. Ich suchte mich zurechtzufinden und nach einem Freiraum, wo ich mich drehen konnte.
Leon ging ins Wohnzimmer zurück. Vom Plattenteller erklang Mozarts Zauberflöte. Die erste Papageno-Arie begleitete er mit einer musikalischen Stimme. Er erzählte, dass er Mitglied des Windhoeker ‘Cantare audire’- Chores gewesen war zu einer Zeit, als der Chor bei dem internationalen Musikfestival 1976 in Dublin den dritten Preis ersungen hatte. Aufgrund seiner Musikalität hätte Leon ein Sänger sein können. Auch kannte er sich in der zeitgenössischen und besonders in der impressionistischen Malerei erstaunlich gut aus. Das zeigten die ausgesuchten, schief hängenden Fotokopien von Bildern an den Wänden des ihm von der Ovambo-Administration zur Verfügung gestellten Drei-Schlafzimmer-Hauses, einem Flachbau mit Asbestwänden, Asbestdecke und Wellblechdach.
Mit Beginn des Sonnenuntergangs legte Leon kleingehacktes Ast- und Wurzelholz in eine von Rost durchlöcherte Blechwanne. In genialer Unordnung lagen die Holzstücke neben- und übereinander verquert, als er das Feuer machte. Dabei imitierte er den Papageno und fragte gut gelaunt: “Ist das nicht herrlich?” Aus dem gekippten Oberlicht des Wohnraumes drang Mozarts Zauberflöte zum Braai-Platz mit dem Quietschen der Grammophonnadel über die ausgefahrenen Rillen der Platte. Feuerrot ging der Sonnenball über dem Horizont nieder und tauchte den Abendhimmel in ein helles Pastellrot.
“Das ist meine Medizin nach einem Tag Oshakati Hospital”, sagte Leon und lachte. Er ging zum blauen BMW der Mittelklasse, der ihm vonseiten der Administration zustand, öffnete den Kofferraum und schleppte Fleisch verschiedener Sorten und eine Rolle >Boerewors<, ein Zweikilonetz mit Kartoffeln, eine Plastiktüte mit vegetarischem Zubehör und eine Zwölferlage Bierdumpies der Marke >Guinness< heran.
Das Feuer in der durchlöcherten Wanne brannte lichterloh, als Leon die ersten Dumpies öffnete, den Willkommensgruß sagte und beim leicht gekreuzten Anstoß der Flaschen das >Prost!< aussprach. Er trank die Flasche in einem Zug fast leer. Als die Flammen das Züngeln einstellten, verteilte er die Glutstücke in der Wanne. Kleine Stücke fielen durch die Löcher und glühten am Boden, dass man mit den Füßen aufpassen musste. Leon legte ein altes Rost mit weit voneinander verlaufenden Längs- und Querstäben auf die Wanne und bestückte das Rost mit Schweinskoteletts, Rinderfiletstücke und zwei Kringeln >Boerewors<. Ein köstlicher Bratenduft stieg auf, dass das Wasser im Mund zusammenlief. Leon öffnete die nächsten Dumpies, und wir prosteten uns zu, als völlig unerwartet ein schweres Geschoss über Haus und Grill zischte und nicht weit weg detonierte. Ich hatte mich so erschrocken, dass mir die Flasche aus der Hand glitt und das auslaufende Bier die Hose bekleckerte. Sofort erinnerte ich mich an die Bombennächte über Köln und die lauten Schießereien der schweren Kanonen beim Anrücken der Roten Armee durch die Oberlausitz, dass der Boden brummte und vibrierte.
“Das kommt hier öfter vor und besonders dann, wenn der Brigadenwechsel stattfindet”, bemerkte Leon und öffnete eine neue Flasche >Guinness< und gab sie mir. Dickbereifte ‘Casspirs’ mit aufgesetzten MGs über den Fahrerhäusern und aufsitzenden Mannschaften rasten über die Straße und wirbelten riesige Sandwolken auf, die über Haus und Grillplatz zogen und dahinter niedergingen.
“Jetzt trinken wir erst einmal. Das ist alles nicht so schlimm. Prosit der Geselligkeit!” Das war Leons Abschlusskommentar zum Ereignis des Schreckens. Er leerte die Flasche und drehte mit der fettverschmiert-verrußten Zange die dampfenden Steaks und die ‘Boerewors’ auf dem Rost und legte einige Kartoffeln dazwischen. Das Bier löschte den Durst nach einem ungewöhnlich heißen Tag. Für mich war Leons Kommentar, dass es sich hier im Norden auch unter den zischenden Granaten leben lässt, mit dem Zweckoptimismus gekoppelt, wobei die Kopplung für jene Menschen in noch stärkerem Maße zutraf, denen es unter der Apartheid schon dreckig genug ging. Aus dem “guten Leben im Norden”, von dem er fast schwärmerisch gesprochen hatte, konnte ich meine ersten realistischen Vorstellungen ziehen, in welcher Lebenssituation Leon Witthuhn steckte.
Das Hospital in Oshakati im hohen Norden lag in Luftlinie etwa fünfunddreißig Kilometer vor der angolanischen Grenze. Der Name “Oshakati” aus der Bantusprache der Ovambos bedeutete >die Stadt der Mitte<. Im Laufe der Jahre sollte es sich zeigen, dass mit diesem Namen eine Schlüsselfunktion verbunden war. Zwar wurde der Schlüsselbart noch von der weißen Administration gedreht, die die meisten Türen für die Schwarzen verschlossen hielt, von denen die Mehrzahl ums Überleben kämpfte. Das Ringen um die Schlüsseldrehung zur Öffnung der Türen für die Schwarzen war von den Gesichtern abzulesen. So sollte Oshakati, das in der Kriegszone lag, eine zentrale Bedeutung zukommen, wenn es um das Oben-unten-Prinzip und seine Umkehrung nach Umsetzung der UN-Resolution 435 in der schwarzen Hierarchie des Herrschens gehen würde.
Doch noch galt das Prinzip der verschlossenen Tür für die Schwarzen. Die Weißen hatten die Macht, und sie hielten sie fest in den Händen. Sie bestimmten das Leben der Menschen, und jene mit der dunklen Haut hatten es deutlich schwerer. Es war die politische Realität, die mit dem Verständnis der Vernunft nicht zusammenpasste. Wer den Schlüssel hatte, der hatte die Macht. Das war die Realität, die mit guter Erziehung und herausragender Bildung nichts zu tun hatte und im Gegenteil, der Bildung mit dem menschlichen Antlitz sprachlos ins Gesicht schlug.
Читать дальше