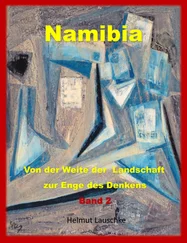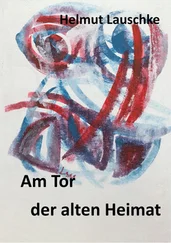Es war kein Abenteuer, als ich fünfzigjährig mit leeren Taschen auf dem andern Kontinent ankam, der der Kontinent der Armen oder der schwarze Kontinent genannt wird. Das Wort >Morgenteuer< trifft mindestens ebenso zu, weil ich weder eine Arbeitserlaubnis noch das Geld hatte für die Scheibe Brot mit dünnstem Aufstrich und der Tasse Kaffee, die ich dringend brauchte. Da gab es den Menschenfreund, ein musikalischer dazu, der mir das Ess- und Trinkbare sowie ein Bett in einem mit Kartons vollgestellten Schlafkabinett anbot. Sein Kalmieren bestand im wesentlichen aus dem überdurchschnittlichen Verständnis für die Schräglagen des Lebens um die Lebensmitte, ob sie gewollt waren oder nicht. Seine ungewöhnliche, in jenem Augenblick als übermenschlich empfundene und herzliche Großzügigkeit mündete in die bald standardisierte Redewendung: “Es ist alles nicht so schlimm.”
Wochen vergingen, bis die auf ein Jahr befristete und auf das Hospital im Kriegsgebiet vor der angolanischen Grenze begrenzte Arbeitserlaubnis eintraf. Es hätte wahrscheinlich Monate gedauert, wenn nicht der amtierende Superintendent aus dem hohen Norden des damaligen Südwest-Afrika die Sachbearbeiterin im über zweitausend Kilometer südlichen Pretoria, der Kommandozentrale der weißen Apartheid, wiederholte Male telefonisch erinnert hätte. Das Facharztzertifikat, weil es ein deutsches und kein britisches war, wurde vom Medical & Dental Council in Pretoria gar nicht zur Kenntnis genommen.
Das Hospital lag nicht weit von der angolanischen Grenze entfernt im Kriegsgebiet, und der Krieg ging weit über die Grenze bis tief nach Angola hinein. In der Wartezeit, die mit Gewichten der Ungewissheit um das bloße Dasein beschwert war, gab es die täglichen Wettläufe und nächtlichen Wettkämpfe zwischen den Worten und den Füßen. Weil die Hände nicht mit den für die Patienten im Hospital dringendst notwendigen Handgriffen in Aktion treten konnten, blieb es dem Wissen mit dem Unwissen vorbehalten, sich mit der Verzögerung und Wartezeit, seiner tieferen Bedeutung und den sich daraus ableitbaren Schikanen schon theoretisch zu befassen, wie sie dann später in der Praxis zu erwarten waren. Es ist der Schatten, als wäre er ein Hund, der ständig nebenher läuft. Die Ungewissheit war weniger, die existentielle Angst dagegen mehr begründet. Beide waren die verlängerten Schatten, die den Daseinsbeginn auf dem neuen, dem unbekannten schwarzen oder armen Kontinent begleiteten. Die Schatten waren so gewaltig, dass sie ein Eigenleben entwickelten, dem das Dasein kümmerlich und hilflos gegenüberstand. Sie hoben und senkten, schoben und drückten sich unheilvoll an den Seiten des Seins entlang. Die langen Schattenarme zogen unter immer neuen Winkeln der Betrachtungsweisen auf und ab und von einer Seite zur andern.
Es war die ziehend-zerrende Dissonanz zwischen dem Wollen der Hände und dem Sollen im Kopf. Dass solch ein Wissen die Schräglage nicht beseitigte, sondern weiter vertiefte, ergab sich aus dem Abzählen der Finger an einer Hand. Die Probleme mussten nicht erst im Kopf sortiert und nebeneinander gerückt werden, sie waren als Schatten unterschiedlicher Stärken eine Realität, die sich in den Schattierungen großflächig und weit nach vorn vor den Füßen auszog. Diese Realität hob sich gegen den glutroten Sonnenauf- und -untergang kontraststark ab, dass sie den Existentialismus mit dem Unsinn und den perversen Schikanen einer lähmenden Apartheid in das Blau des Himmels brannte. Dabei war rasch erkennbar, dass man den Unsinn mit dem verfilzten Drum und Dran, was mit der bloßen Lächerlichkeit begann und sich bis zur Unerträglichkeit steigerte, nicht wie den steckengebliebenen Nagel aus dem zurückgelassenen Brett herausziehen konnte.
In der Nacht wuchsen die Spannungen zwischen Wollen und Sollen ins Unerträgliche, dass erst die frühen Morgenstunden den verkürzten Schlaf hergaben. Das, was sich im Traum stemmte und wehrte, ließ sich wörtlich etwa so fassen:
Der Raum, er weitet sich ins Unendliche.
Weggesprengte Wände mit dem Erdgeschmack der Bitternis,
dem Sand, den Steinen,
je länger und tiefer es geht.
In der Weitung brauchst du nicht fliegen,
aber ruhig liegen musst du.
Ich weiß, dass auch du es tun wirst,
nicht anders wie die andern
mit angelegten Armen und gestreckten Beinen.
Beieinander liegen die Körper
in Leinen verschnürt.
Und weiter, immer weiter dehnt sich der Raum
und noch viel weiter, weil es kein Ende nimmt.
So etwa trug der Kopf die Last ums Dasein durch die Nacht. Die normale Physiologie des Wechselrhythmus von Tag und Nacht war abhanden gekommen. Die Tage zogen sich in die Länge, begonnen und begrenzt von den feuerroten Auf- und Untergängen. Die Gefühle schaukelten und trieben das Innerste hin und her beziehungsweise auf und ab. Ihnen drückte sich als weiterer Teil die kochende Hitze auf. Der Wecker war der knurrende Magen. Von Mücken zerstochen, weil das Gitternetz zerrissen und gelöchert war, ging es aus dem Bett, und aus der Brause kam das heiße Wasser, sonnenheiß vom Vortag.
Ich betrachtete abgemagerte Frauen und Kinder in den schweigenden Menschentrauben auf dem Vorplatz vor der Rezeption um sieben Uhr morgens, später dann im Wartesaal des
>Outpatient department<. Die Erkenntnis, dass allgemeiner Hunger die Menschen an der Leine hat, hatte hier seine volle Gültigkeit. Spontan kam die Vermutung auf, dass Menschen im Zustand dieser Magerkeit sich nicht im Reden verausgaben, weil sie die Kräfte zur Geduld brauchen, um die Stunden hindurch zu warten, bis sie vom Arzt gesehen werden.
Die fragenden Blicke zum Himmel blieben so unbeantwortet wie die Orientierungsblicke in die in beißendem Schweiß gehüllten, dünnbeinig und dünnarmig, armselig gekleidet stehenden, vor mageren Bäuchen und auf knorrigen Rücken kindertragenden Müttern und auf dem Boden sitzenden alten und behinderten Menschen. Es war noch keine neun, als das Hemd auf der Haut klebte und der Mund trocken war. Heiß und drückend stand die Luft über Kopf und Kragen in einer dichten Menschenmenge, dass ein Kompass nötig war, um zu zeigen, wo es langgeht. Die Augen waren gerötet vom wenigen Schlaf und eingeriebenen Sand, von dem es außer den Steinen und zu jeder Zeit im Überfluss gab. Wo man hin und wie weit man sah, wo man ging, man trat auf Sand und Steine als den afrikanischen Wegerich, der gesäumt war von sperrigen Langdornbüschen.
Ich forderte das Dasein auf dem Sand über dem zerbröckelnden Urgestein im verschwitzten Hemd mit schwitznassen Füßen auf den Korksohlen der Birkenstock-Sandalen und den leeren Taschen und zwei Koffern mit dem unnützen Plunder geradezu heraus. Es war die unvorbereitete und ungewollte Herausforderung mit der Unsicherheit und Bodenlosigkeit durch das Fehlen von Grundwissen und Grunderfahrung, was Afrika und seine Menschen betraf. Da musste das kleine, aus Europa mitgebrachte Daseins-Einmaleins ins Auge gehn, wie es zu bewerkstelligen war, sich unter diesen Umständen am Leben zu erhalten.
Im Grundgefühl war das Wegrutschen ins Leere, eben in das Bodenlose. Wie sollte ich da auf dem kargen, rissig vertrockneten Boden den schweißüberzogenen wartenden Trauben magerer Menschen als Arzt näherkommen oder gar auf Hautfühlung gehen? Oder andersherum: Gab ich der Umgebung und ihren Menschen die Chance, an mich heranzukommen? Die Absicht war doch, dass ich gekommen bin, um mit den Händen die Chirurgie an diesen Menschen auszuführen. Und das in der Kriegszone mit den Granateinschlägen nicht nur in der Ferne, sondern bis an das Hospital heran, wo es wegen der Gefahr fürs eigene Leben nur wenige Ärzte gab. Andererseits war das Hospital heruntergekommen und überfüllt. In den Krankensälen roch es nach Urin. Patienten lagen zwischen den Betten auf dem Boden. Kleinkinder teilten sich zu zweit und zu dritt ein Kinderbett. Wie sollte man da die Beobachtungen verstehen und halten unter den Umständen des ausgerutschten, aus der Normalität weggerutschten Lebens? Und wie sollte man sich selbst einbringen und sich als Arzt und Chirurg nützlich machen, wenn es vom Medical Council in Pretoria, dem Machtzentrum der anachronistisch übergestülpten Apartheid mit den strammgezogenen Verbotsleinen noch keine Arbeitserlaubnis gab?
Читать дальше