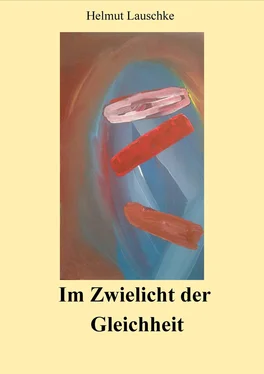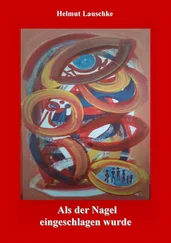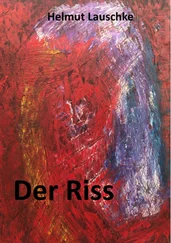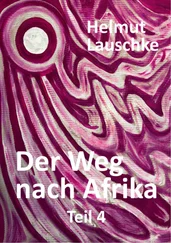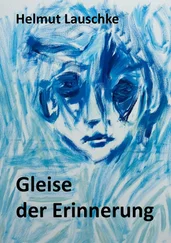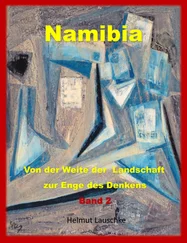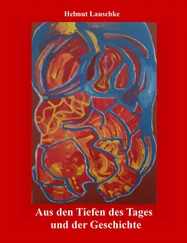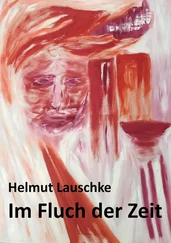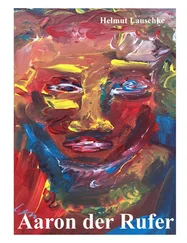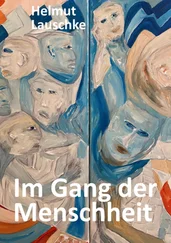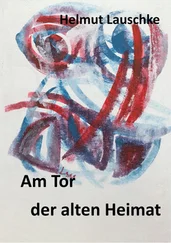Im letzten Krankenraum des orthopädischen Männersaals lagen acht Patienten, die Grund zu ernster Sorge gaben, entweder weil die Wundinfektionen unbeherrschbar schienen oder weil andere Komplikationen die Wundheilung verzögerten. Unter den Patienten waren jene, deren Amputationsstümpfe am Unterschenkel infolge einer mangelhaften Blutzirkulation klafften und den süßlichen Fäulnisgeruch des toten Gewebes verströmten. Andere Patienten hielten die Hand mit gerunzelten, mumifizierten Fingern entgegen. Ein etwa fünfundzwanzigjähriger Patient brachte bereits sein drittes Jahr im selben Bett zu. Er saß mit großen Druckgeschwüren über dem rechten Gesäß auf unnatürlich verbogenen Beinen und bewegte seine weniger verbogenen Arme auf unnatürliche Weise, fast gespenstig. Die Ursache des Leidens war die unvollständige Knochenbildung [Osteogenesis imperfecta] , ein angeborenes Leiden, weshalb er schon als Kind mit Schienen und Operationen, insbesondere an den Beinen, behandelt wurde. Doch das alles führte zu keinem Erfolg auf Dauer. Das Gehen an Stöcken und Krücken, das in den Kinderjahren möglich war, bescherte ihm die Brüche an den Armen, die trotz der Behandlungsversuche in Fehlstellungen endeten, so dass er seit über zehn Jahren gehunfähig war. Vater und Bruder brachten ihn auf dem Eselskarren zum Hospital, da sie ihn zu Hause nicht mehr versorgen konnten. Einen Rollstuhl gab es nicht.
Die Saalrunde erwies sich als ein afrikanischer Augenöffner. Ich sah eine Wirklichkeit, die ich in Deutschland nur aus Büchern kannte. Nach der Saalrunde erfolgte ein Gespräch bei einer Tasse Tee im >Doctors tearoom<, der neben dem Umkleideraum und durch ein großes Glasfenster vom OP-Korridor mit den gegenüberliegenden Operationsräumen getrennt war. Hier sprach Dr. van der Merwe in natürlicher und menschlicher Weise von der Komplexität der Probleme und den daraus resultierenden Schwierigkeiten in der Behandlung der Patienten, für die er zuständig war. “Die meisten Frakturen behandeln wir konservativ mit Gipsen und Schienen. Bei einigen Patienten habe ich eine Knöchelfraktur mit einer Schraube versorgt.” So schilderte er die Situation, für die der Mangel an Instrumenten und Material sowie die fehlende praktische Erfahrung die Gründe waren, weshalb Verletzungen mit schweren und Mehrfachbrüchen über siebenhundert Kilometer weit nach Windhoek gebracht wurden.
In einigen Fällen assitierten ihm bei den Operationen die >Consultants<, die zweimal in der Woche vom Lazarett des Militärflughafens in Ondangwa, etwa vierizg Kilometer östlich von Oshakati, gebracht wurden. Doch diese >Consultants<, in Offiziersrängen nicht unter einem Colonel, waren in der Regel Spezialisten der Chirurgie, die derartige Verletzungen mit Frakturen direkt ins Militähospital nach Pretoria fliegen ließen. Auf die Frage, ob die Arbeit ihn nicht überfordere, antwortete Dr. Van der Merwe, dass er froh sei, seine Dienstzeit als Arzt in Oshakati zu verbringen, denn hier könne er die Erfahrungen sammeln, die ihm später in Südafrika zugute kämen. “Auch gibt es hier Weiterbildung”, fuhr er fort, “jeden Freitag halten die Spezialisten einen Vortrag über aktuelle Themen aus der Chirurgie, dem sich eine Diskussion anschließt. Das ist für uns, die wir noch in der Ausbildung sind, sehr nützlich.”
Nichts erinnerte in der ersten Orientierungsrunde aufgrund der allgemeinen Armut und der breiten, oft erschreckenden Erbärmlichkeit an Land und Leben der Menschen meiner Herkunft. Gärten und Grünanlagen in der Umgebung sauberer und funktionstüchtiger Krankenhäuser, was zur Stärkung der Patienten beitrug, musste in der Kargheit des ariden afrikanischen Bodens abgeschrieben werden. Wie draußen, so war es drinnen. Der Arbeitstag entpuppte sich als heiß, steinig, mühsam und zehrend. Dazu der wenige und gestörte Schlaf, die Granateinschläge im Dorf und um das Hospital herum und die donnernden Erwiderungsabschüsse aus den schweren Haubitzen aus dem nahegelegenen Camp.
Eine Granate schlug in den Wasserturm am anderen Dorfausgang ein, eine andere den Wasserturmkopf hinter dem Hospital “lack”. Der Wasserturm am Dorfausgang erhielt einen Treffer, dass ihm der >Wasserkopf< in den Schiefstand rutschte. Auf dem Hospitalgelände entstand ein knöchelhoher See vor den Wohnbaracken des Personals und den drei Arzthäusern, dass Schwestern und Ärzte mit dem klappernden Kleintransporter zur Arbeit geholt und nach dem Dienst zurückgebracht wurden. Die Reparatur nahm vier bis fünf Tage in Anspruch, währenddessen das Hospital ohne Wasser war. Hinzu kamen die unvorhergesehenen Stromausfälle. Von den zwei Dieselgeneratoren für den Notstrom war einer defekt, und für den andern, der es tat, fehlte der Dieselkraftstoff.
Vieles kam zusammen, dass es im Kopf schwirrte und unter den Sandalen knirschte. Es war kein Wunder, dass der Gewichtsverlust den rapiden Verlauf nahm, dass in Abständen von wenigen Wochen der Gürtel enger geschnallt werden musste. Zu den vier ursprünglichen Löchern kamen mit den ersten zwei Jahren vier weitere hinzu, die mit dem Pfriem in gleichen Abständen durch das Gürtelleder gestochen wurden.
Das ist eine Notiz im ersten Jahr:
Du,
in schwimmenden Gedanken,
ob in Rückenlage,
ob im Schmetterling.
Weit greifen sie aus,
mager gewordene Arme schlagen das Rad
durchs Wasser,
durch die Luft.
Anderes ging, doch anderes kam,
das draußen wie auch drinnen.
Ziffern fielen von den Wänden,
andere steckten sie sich weg.
Als schmückten sie sich mit dem Gekämmten,
denn zu gewinnen gab es nichts.
Es war das Erlebnis der ersten Tage in Afrika: Gegenständlich blieben die Menschen draußen vor dem Hospital wie drinnen im Wartesaal und in den Krankensälen die Wiederholung des Vortages, dann der Vortage. Die Schwarzhäutigkeit der Warteschlangen und der Trauben auf den Wartebänken in den scharfen Schweißwolken war arm und grau und geflickt gekleidet. Das Spindeldürre der Arme und Beine der kleinen, meist nackten Kinder stach schmerzlich in die Augen. Spindeldürre Kinderbeine sahen wie Stöcke aus. Die Augen in den abgemagerten Kindergesichtern waren groß. Andere Augen waren eingesunken, vor allem bei jenen Kindern, die die ausgebuchteten Kwashiorkor-Wasserbäuche vor sich hertrugen.
Es musste erst verstanden werden, dass es die letzte Phase mit den Mängeln war. Die Kinder waren zu schwach, um länger zu stehen. So saßen sie auf dem Boden zwischen den Erwachsenen, ihrerseits mit den Sorgenfalten in den Stirnen und den Hungerfalten um ihre Jochbögen. Es war das Warten auf die Befreiung, die oft noch am selben Tage eintrat. Dann lagen sie auf dem Rücken oder auf der Seite mit ihren kleinen, eingefallenen Gesichtern und den großen glanzlosen Augen, die zu schließen sie nicht mehr geschafft hatten.
Das europäische Auge brauchte länger, um die schwarzen Gesichter voneinander zu unterscheiden. Nach Monaten begann es, dass sich der Mensch in diesem Winkel der Welt gegenständlich und physiognomisch entfaltete. So wurde aus dem Unterscheiden ein Lernprozess ohne Ende, der durch das schwarzadaptierte Hin- und Hineinsehen die tieferen afrikanischen Erkenntnisse vom Menschen brachte. Sie erst machten das Leben und seine Umstände verständlich, wie sie von den Machthabern der weißen Apartheid durch die pigmentbedingte Wegnahme von Integrität und Menschenwürde den schwarzen Gesichtern aufgezwungen worden waren.
Das Kräuselhaar entsprang dem Genbrunnen ebenso wie der Melanozytenreichtum in der Haut und das Dunkelbraun der Regenbogenhäute. Doch gab es Scheitelmitten, wo sich ergraute Haare sträubten, als würden die Gedanken darunter aus den Köpfen schießen. Leute mit Hüten, um was zu verstecken, die gab es nicht, sie wären hier auch fehl am Platz gewesen. Die Hälse der Menschen waren dünn und faltig. Schon die jüngeren Menschen sahen älter oder alt zum Erschrecken aus. Auch Kinder trugen die Zeichen des vorzeitigen Alterns mit sich herum. Die Wangen der Menschen waren durchweg eingefallen, und die Zeichen der Lebensverkürzung markierten über jeden Zweifel die Gesichter. Diesen Menschen musste geholfen werden, und das so schnell wie möglich. Jedes Zögern in der Hilfeleistung war ein Vergehen an den Menschen in dieser trostlosen Erbärmlichkeit gewesen.
Читать дальше