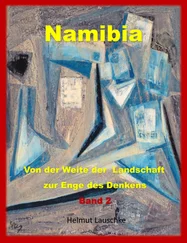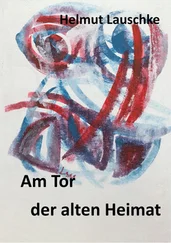Ich setzte mich an der anderen Schreibtischseite dem Superintendenten gegenüber auf einen harten Stuhl. Der Superintendent schaute auf seine Armbanduhr, rief die Sekretärin und bestellte Tee mit Zucker und Milch. Es war die Wartezeit, als er fragte, ob ich einen ersten Eindruck vom Hospital bekommen hätte. Meine Blicke fuhren die Fensterfront ab, fixierten die schütter begrünten Äste eines alten Baumes mit einigen, ins Auge springenden dicken Aststümpfen. Der Baum stand zwischen dem Flachbau der Administration mit seinen Klimaanlagen und dem Patientenflachbau gegenüber ohne eine einzige Klimaanlage. “Der erste Eindruck sprengt alle meine bisherigen Erfahrungen. Eine solche Ansammlung von Patienten und Verletzten habe ich noch nicht gesehen.” Das sagte ich und zählte die Aststümpfe von unten nach oben. Dann nahm ich den Blick vom Baum weg und richtete ihn auf den Superintendenten.
Der Superintendent war ein Mittvierziger mit einem leicht geschwollenen Gesicht und tiefbraunen Augen unter dem dunklen Wildwuchs der Brauen. Seine Nase hatte den breiten Rücken mit dem Verdacht der beginnenden Knollenbildung über der Nasenspitze. Sein Mund führte dicke Lippen noch europäischer Ausmaße und gab beim Öffnen die Sicht auf zwei blendend weiße Zahnreihen frei. Das Schwarz seines buschigen Haarwuchses wurde an den Schläfen von ersten Grautönen des frühen Alterns durchzogen.
“Lieber Kollege”, sagte der Superintendent, “seitdem ich hier Superintendent bin, und das sind jetzt fünf Monate, haben sich die Dinge bereits gebessert. Zwei der vier Operationstische wurden überholt, einige alte Instrumente wurden durch neue ersetzt, und die Zahl der Ärzte wurde von elf auf vierzehn erhöht. Es ist richtig, dass diese Zahl für eine ordentliche Versorgung der Patienten noch immer zu klein ist. Doch bedenken Sie, dass hier Kriegsgebiet ist. Dafür ist diese Zahl doch schon beachtlich.”
Die Sekretärin, eine junge schwarze Frau, schön aufgrund ihrer stimmenden Proportionen, brachte das Tablett mit einer Kanne Tee, zwei Tassen, Zuckerschale und Milchkännchen. Beim Abstellen des Tabletts sagte sie mit wohlklingender Stimme, dass Dr. Erasmus, der Sekretär der zentralen Gesundheitsverwaltung angerufen und um Rückruf gebeten habe, und dass Dr. Hutman ihn sprechen wolle. “Die Unterredung kann jetzt nicht stattfinden”, sagte der Superintendent, “Sie sehen, dass ich mit dem Kollegen”, er verwies auf mich, “im Gespräch bin, der aus Deutschland kommt, um hier als Chirurg zu arbeiten.” Die Sekretärin gab mir ein herzliches Lächeln, denn am Hospital herrschte Ärztenot. “Sagen Sie Dr. Hutman, dass ich heute keine Zeit habe. Wir können morgen früh nach der Besprechung miteinander reden”, erklärte der Superintendent.
Mit einiger Mühe erhob er sich aus dem gepolsterten Stuhl und goss den Tee in die Tassen. “Nehmen Sie Zucker und Milch?” Ich bat um zwei Löffel Zucker und ohne Milch. Der Superintendent sagte, dass für die Arbeitserlaubnis, die erforderlich war, das Medical & Dental Council in Pretoria zuständig sei. Die Prozedur würde wahrscheinlich eine Woche in Anspruch nehmen. Er war optimistisch und merkte an, dass das Council bisher immer behilflich war. Des Weiteren bot er an, dass ich in seinem Haus wohnen könne, bis die Arbeitserlaubnis eintreffe und eine andere Unterbringung gefunden würde.
Es klopfte heftig gegen die Tür. Ohne das “Herein!” abzuwarten, trat ein mittelgroßer Mann in Uniform der südafrikanischen Streitmacht ein. Sein Haar über dem blassen Gesicht war rechts gescheitelt. Die Augen waren dunkelbraun und sprühten das Feuer des Angriffs. Der Superintendent stellte mir den knapp dreißigjährigen Arzt mit Namen vor. Dieser setzte sich in einen gepolsterten Stuhl und hielt die Zunge für eine geraume Zeit unter Kontrolle.
Dieser junge Arzt in Uniform musterte mich mit seinen dunklen, nervös hin und her fahrenden Augen mit einem nicht zu übersehenden Ausdruck der Feindseligkeit. Es machte ihm nichts aus, das erste Orientierungsgespräch, das der Superintendent mit mir führte, zu unterbrechen. Die Aufdringlichkeit überraschte, mit der der junge Arzt fragte, ob ich auf Urlaub sei oder beabsichtige, hier zu arbeiten. Er sagte, dass die Auswirkungen des Krieges nicht unterschätzt werden sollten, der in den letzten Monaten an Schärfe zugenommen habe, dass die Zahl der Verletzten stark gestiegen sei.
Der Arzt in Uniform bewies sein Talent im Sprechen, aber nicht im Zuhören. Das zeigte er, als er einen Zettel aus der Hemdstasche zog und mit einem Katalog von Beschwerden loslegte. Er nahm keine Rücksicht, dass die beiden anderen Kollegen miteinander sprechen wollten. Der Jungarzt beschwerte sich über die mangelnde Zusammenarbeit der Schwestern und Pfleger im chirurgischen Männersaal. Sie würden die Verbände nicht zu den vorgeschriebenen Zeiten wechseln, würden die Infusionen und Bluttransfusionen nicht pünktlich anhängen und die Injektionen nicht, wie vorgeschrieben, geben. Sie verweigerten schlichtweg ihre Kooperation.
Der Versuch, das Problem in friedlicher Weise zu besprechen, scheiterte daran, dass dieser Arzt den Superintendenten nicht aussprechen ließ. Bei dem langen Beschwerdemonolog mit dem Herausstellen seines persönlichen Einsatzes, in dem er sich nicht unterbrechen ließ, bekam ich den Eindruck, dass das Uniformtragen die Zurschaustellung der Macht der Besatzer, wenn auch an völlig falscher Stelle, war. Ich erinnerte mich an meine Kindheit zurück, als Uniformträger ihre Macht in oft arroganter Weise zur Schau stellten und sich wichtig nahmen, so dass es für die Erwachsenen entweder lächerlich oder gefährlich wurde.
Der Superintendent war Zivilist, und als solcher lag er mit dem ärztlichen Direktor, der es sich in der Uniform eines Colonels der südafrikanischen Streitkräfte auf seinem Sessel im geräumigen und angenehm klimatisierten Büro bequem machte, im Clinch. Die Sorgen dieses Direktor kreisten primär um den Status seines Gebisses und die zahnärztliche Behandlung, dass sich seine Tätigkeit auf die Herausgabe von Erlassen beschränkte, die am laufenden Meter kamen und von Woche zu Woche in Worten der Diskriminierung immer schärfer wurden.
Diskriminiert wurden Menschen der schwarzen Hautfarbe, die im Norden des Landes vor der angolanischen Grenze, wo der Krieg hauste, am meisten litten. Dagegen kämpfte der Superintendent mit den Argumenten des gebildeten Zivilisten für diese >Bantu<-Menschen gegen die bornierten und machtbewussten Uniformträger, die ihre Aufgabe in Beschwerden und der Fließbandanfertigung von Erlassen sahen.
Der zivile Superintendent war ein Mensch mit Herz, der seine Arbeit in der Hilfe für die Menschen verstand, dem das Herz schwer wurde, wenn es wegen der Behandlung von Patienten zu Zusammenstößen mit den Uniformträgern kam. Er setzte sich persönlich dafür ein, dass das Hospital für die Zivilbevölkerung offenstand, um den leidgeplagten Menschen die Hilfe zukommen zu lassen, die sie dringend brauchten. Für ihn als Arzt gab es wegen der Hautfarbe keinen Unterschied in der Behandlung. Als Patient verlangt jeder Mensch die gleiche Andacht und Verbindlichkeit vom Arzt.
Hutman, der Jungarzt in Uniform mit dem sorgfältig zusammengefalteten Barett unter der rechten Schulterklappe mit dem kleinen Leutnantsstern, ließ den Superintendenten nicht ausreden, der erst auf Englisch und dann in Afrikaans versuchte, auf die Beschwerdepunkte und ihre Ursachen einzugehen. Er musste energisch werden und bat den jungen Arzt, ihn ausreden zu lassen, ohne ihn ständig zu unterbrechen. Er sagte es dem Arzt in Uniform, dass er die Injektionen und Infusionen vor Operationsbeginn zu setzen habe. Er versuchte den jungen Kollegen zu überzeugen, dass eine gute Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal zu erreichen sei, wenn er als Arzt freundlich ist und mit Geduld und Verständnis auf die Probleme im Krankensaal eingehe. Das Problem fehlender Antibiotika und Infusionslösungen könne er als Superintendent auch nicht lösen, weil er und das Hospital auf die Zentralapotheke angewiesen seien, die über siebenhundert Kilometer entfernt ist.
Читать дальше