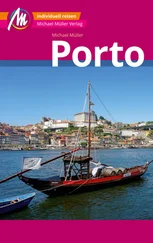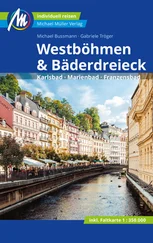„Das ist ja eine merkwürdige Geschichte, man wird den Beklauten wohl nicht ausfindig machen und somit marschiert jetzt alles Geld in die Asservatenkammer, eigentlich schade, nicht wahr?“, kommentiert der Ältere. Der Andere hebt resigniert die Schultern und murmelt süffisant:
„Ja, ehrlich währt am längsten.“ Hanna hat sehr wohl verstanden was ihre Kollegen damit sagen wollen. Sie ist ärgerlich über deren Borniertheit. Ohne sich den Ärger anmerken zu lassen, gibt sie zu bedenken:
„Liebe Kollegen, es ist doch immerhin möglich, dass wir es mit Falschgeld zu tun haben, was hätte Unehrlichkeit da für einen Sinn?“ Dabei strahlt sie beide freundlich lächelnd an und fügt hinzu, „auf jeden Fall muss diese Möglichkeit geklärt werden.“ Die beiden Polizisten reagieren betroffen und nicken nun beflissen. „Ja klar, das ist wohl wahr! Das muss unbedingt untersucht werden“, antwortet der Ältere und fährt mit zwei Fingern über die Nase, sodass die Hand seinen Mund verdeckt. Hanna ist nicht klar, ob seine Bemerkung ironisch gemeint ist, er sie weiter auf den Arm nimmt, oder ob es ihm damit ernst ist. Jedenfalls scheint für ihn die Angelegenheit beendet zu sein. „So, dann macht mal weiter“, fordert er die beiden auf und wendet sich von ihnen ab. Er schaut beim Weggehen nochmals auf den Bildschirm stutzt und fragt:
„Sag’ mal Kollegin, wo genau hat sich der Diebstahl abgespielt?“ „Na, hier auf dem Bahnhof ‚Zoo’, das sagte ich doch schon.“
„Auf dem U- oder auf dem S-Bahnhof?“, fragt er weiter.
„Na, auf dem U-Bahnhof, warum?“ Hanna ist irritiert.
„Liebste Kollegin, das hattet ihr wohl noch nicht in eurer Ausbildung“, sagt der Ältere herablassend. Hanna versteht nicht, worauf er hinauswill und schaut ihn unsicher an.
„Du bist hier bei der Bundespolizei. Die U-Bahn gehört nicht in unsere Zuständigkeit. Das müsstest du doch eigentlich wissen.“ Im gleichen Atemzug schaut er seinen Kollegen an und sagt vorwurfsvoll:
„Wo hattest du deine Augen und Ohren. Wir hätten uns die Arbeit und Zeit sparen können, wenn du gleich genauer nachgefragt hättest.“
„Aber sie hat doch die U-Bahn gar nicht erwähnt!“, empört sich dieser, „ich ging davon aus, dass es sich um den Fernverkehrsbahnhof …“ Hier wird er durch eine ärgerliche Geste des Älteren unterbrochen, der jetzt laut verkündet:
„Nee, nee Kollegin, die Anzeige musst du auf deiner Dienststelle aufnehmen lassen. Bei uns bist du auf der falschen Beerdigung.“ Er lacht über seinen Witz und sagt dann jovial: „Nimm die Brieftasche wieder mit, trotzdem war es nett, dich kennenzulernen.“ Er reicht ihr eine Plastiktüte, in die Hanna, nun etwas verlegen, die Brieftasche verstaut. Sie verabschiedet sich schnell, verlässt die Dienststelle und geht zurück zum U-Bahneingang, um ihren Weg zur Arbeit fortzusetzen. Verärgert über sich und ihre selbst geschaffene Blamage, bemerkt sie nicht, dass ihr eine Frau folgt.
* * *
Lydia erreicht den Bahnhof „Zoo“. Sie ist unauffällig gekleidet und wirkt mit ihrer Plastiktüte in der Hand wie eine Hausfrau, die vom Einkauf kommt. Sie geht hinüber zur Verkehrsinsel und mischt sich unter die Leute, die dort auf die Busse warten. Von hieraus kann sie gut den Eingang der Polizeidienststelle beobachten.
Nach etwa zehn Minuten erscheint die Frau, und Lydia folgt ihr. Es geht mit der U-Bahn der Linie zwei zum Sophie-Charlotte-Platz und ein kurzes Stück Weg auf dem Kaiserdamm. Von der Parkseite her betritt die junge Frau das große graue Polizeigebäude - vermutliche ihre Dienststelle.
Zunächst erkundet Lydia die Umgebung des Gebäudekomplexes. Sie geht am Sophie-Charlotte-Platz entlang bis zur Horststraße, biegt dort links ein. Dort befindet sich eine Einfahrt zu einem großen Innenhof. Einige Polizeifahrzeuge sind dort geparkt. Ein weiterer Hauseingang führt in das Gebäude. Dann erreicht sie über die Wundtstraße den Kaiserdamm. Von hier führt ihr Weg an der Front des Polizeigebäudes entlang, vorbei am Hauptportal, zurück zum Park. Insgesamt hat sie vier Eingänge gezählt. Diese allein zu überwachen, ist unmöglich. Deshalb entscheidet sie, zunächst den parkseitigen Eingang, durch den die Polizistin das Haus betreten hat. Im Schatten der Bäume ist die Temperatur angenehm. Sie findet eine mit Fantasiezeichen in weißer Farbe beschmierte Bank. Von hier aus kann sie den Eingang des Gebäudes gut im Auge behalten. Ihrer Handtasche entnimmt sie ein Buch und beginnt zu lesen. Das ist schwierig, weil sie alle paar Minuten vom Text aufschauen muss, um den Eingang des Gebäudes zu kontrollieren. Immer wieder muss sie sich in die Handlung des Romans gedanklich neu einfädeln und das, was sie liest, prägt sich nicht ein. Außerdem lenkt jede neue Zigarette ab, die sie fast pausenlos entzündet. Lydia ist Kettenraucherin. Sie hasst Observationen. Zu lange hat sie diese Art Job betrieben. Es ist immer dasselbe: Warten, Rauchen, unauffällig Abstand halten und wieder Warten, Rauchen …, oftmals ohne greifbare Ergebnisse. So wird es hier wohl auch sein. Sollte die Polizistin in der Spätschicht arbeiten, kann sie erst zum Dienstschluss, etwa um zweiundzwanzig Uhr, die Heimfahrt antreten. Das bedeutet weitere Stunden Warterei. Und es ist keineswegs sicher, dass sie beim Verlassen des Gebäudes wieder dasselbe Tor benutzen wird, wie vor Dienstbeginn.
* * *
Kurze Zeit später sitzt Moussard im Bus, um seinen Auftraggeber in der Charlottenburger Helmholtzstraße aufzusuchen. Dessen Büro befindet sich zusammen mit vielen anderen im Fabrikgebäude eines ehemaligen Elektrokonzerns. Moussard kennt den Weg, er war schon einmal dort.
Seine Gedanken gehen zurück zur ersten Begegnung mit dem Auftraggeber. Als er damals das Gebäude betreten hatte, um schriftliche Instruktionen abzuholen, wies ein Schild am Eingang mit der Aufschrift „Brunei-Corporation“ auf das Büro im dritten Stock des linken Quergebäudes. Zu seiner Überraschung traf er in dem Raum zwei Personen an. Von einem persönlichen Kontakt war nie die Rede gewesen. Moussard hätte einen solchen auch abgelehnt. Nun sah er sich plötzlich einem zwergwüchsigen, grauen Mann gegenüber und dessen bulligem, kahlköpfigen Leibwächter, der im Vergleich zu seinem Schützling wie ein Gigant wirkte.
Der kleine Mann war in jeder Hinsicht grau: gekleidet in einem grauglänzenden Blouson, mit hochgestelltem Stehkragen, dem chinesischen Mao-Anzug ähnlich und einer gleichfarbigen Hose; grau auch das fahle, breite Gesicht, mit hervorquellenden, auseinander stehenden, etwas entzündeten Augen. Der starre Blick erinnerte ihn an einen Blinden. Auch die zusammengepressten Lippen, die einer tiefen Narbe ähneln, waren blutlos-grau. Sein schütteres spärlich graues Haar trug er straff nach hinten gekämmt.
Er saß auf einem Schreibtischstuhl. Seine kurzen, krummen Beine reichten nicht bis zum Boden. Das ganze Männchen wirkte dadurch lächerlich. Im Stillen hatte Moussard ihn den „Pekinesen“ getauft. Als er die beiden im Raum bemerkte, hatte er instinktiv seine Pistole gezogen und sie auf den bulligen Leibwächter gerichtet, woraufhin der kleine Graue mit klarer, etwas quäkender Stimme in herablassendem Tonfall sagte: „Guten Tag, Monsieur Moussard! Stecken Sie Ihre Waffe ein, Sie werden sie hier nicht benötigen.“ Eine Reihe schief gewachsener Vorderzähne wurden sichtbar. Er sprach ein sehr gutes Französisch und diese Begrüßung ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, wer der Chef war. Er hatte dann geduldig gewartet, bis Moussard die Pistole zögernd senkte und sie schließlich in seinem Jackett verschwinden ließ.
„Besten Dank Monsieur, sehr freundlich von Ihnen. Bevor wir unsere Angelegenheit besprechen, möchte ich mich zunächst einmal vorstellen“. Er hüstelte. Nach einer Kunstpause erklärte er langsam mit bedeutungsvoller Betonung, als würde er ein Staatsgeheimnis verkünden:
Читать дальше