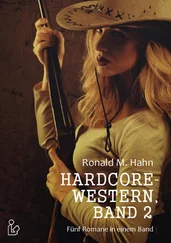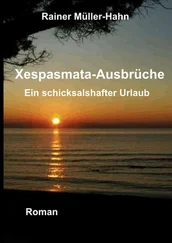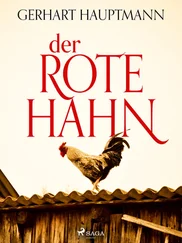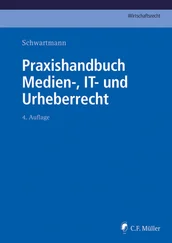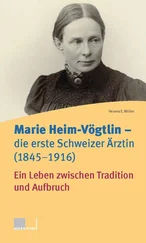Die beginnende Schimpfkanonade am anderen Ende der Leitung unterbricht er schroff mit dem Hinweis, dass er das restliche Material noch beschaffen werde. Alles Weitere am nächsten Tag. Ohne den Angerufenen noch zu Wort kommen zu lassen, beendet er das Gespräch abrupt. Moussard ist ganz ruhig, die Schreierei des Mannes berührt ihn nicht.
Am nächsten Tag wird er ihn pünktlich aufsuchen, liefern was er liefern kann, Geld in Empfang nehmen und später mit dem Flugzeug nach Brüssel zurückkehren.
Marseille, Mittwoch, 18. Mai
Nach all den Strapazen wollte Jerôme sich richtig ausschlafen und hatte seinen Wecker auf 10:00 Uhr gestellt, früh genug, um pünktlich zur Besprechung am Mittag zu erscheinen. Trotz Müdigkeit und Erschöpfung erlebte er die Nacht vom Dienstag zum Mittwoch als sehr unruhig. Sein Schlaf in kurzen Etappen war wenig erholsam.
Er ist wieder wach, als es draußen hell wird, wälzt sich im Bett, findet keine bequeme Position, um wieder einzuschlafen. Dazu kommen sorgenvollen Gedanken die um die Familie und das Geschehen in Gabun kreisen. Erst nach einer endlos scheinenden Zeit findet er wieder in den Schlaf. Dann träumt er wirres, Angst erregendes Zeug, wacht erschreckt auf und grübelt weiter. Dieses Wechselbad zwischen Albtraum und Gedankenschleifen setzt sich fort, bis der Wecker schließlich klingelt.
Er ist müde und fühlt sich vollkommen zerschlagen. Es scheint, als ob alle Belastungen und Ängste der letzten Tage sich in dieser Nacht verdichtet haben und seinen Schlaf und seine Kraft als Tribut gefordert haben.
Mühsam steht er auf und geht etwas taumelnd zur Toilette. Nichts geht ihm zügig von der Hand, weder die Morgentoilette, das Ankleiden noch die Zubereitung eines kärglichen Frühstücks, dass er ohne Appetit herunterwürgt. Dann ist Eile geboten.
Er packt seine Reisetasche, verstaut darin Geld, Papiere, seine Waffe mit Munition, die Festplatte des Rechners sowie Hygiene-Artikel und ein paar Sachen zum Anziehen. Zuletzt steckt er die Original CDs ins Jackett.
Ein Taxi bringt ihn zunächst zum Busbahnhof, wo er seine Reisetasche in einem Schließfach deponiert. Diese Sachen will er nicht mit in die Firma nehmen.
Einige Minuten später erreicht er das große, futuristische Gebäude in der Avenue du Prado, den Hauptsitz der Laboratoires Biochiques Trouvaille SAR.
Es ist ein asymmetrisch aus Stahlbeton und Glas gestalteter, achtgeschossiger Bau. In den bläulich gefärbten Scheiben spiegelt sich die Mittagssonne, die um diese Zeit erhebliche Wärme ausstrahlt. Jerôme eilt durch die großzügig angelegte Lobby, vorbei am Empfang, zeigt der Empfangsdame seinen Firmenausweis - eigentlich unnötig, denn beide kennen sich. Sie begrüßt ihn freundlich mit den Worten:
„Hallo, Dr. Jarcol, schön Sie zu sehen, man erwartet Sie bereits oben …“, mehr kann Jerôme nicht hören, denn nachdem er ihren Gruß flüchtig beantwortet hat, befindet er sich bereits im Aufzug.
„Oben“ bedeutet das achte Stockwerk oder „der Olymp“, wie man die Etage mit den Vorstandsbüros im Firmenjargon bezeichnet.
Der Konferenzraum dort ist eigenartig eingerichtet. Helle, gespachtelte Wände, davor eine Konstruktion aus alten Holzbalken und Verstrebungen, angeordnet in der Art eines Fachwerkbaus. Acht gediegene bequeme Ledersessel, gruppiert um einen großen hölzernen Konferenztisch, dessen Platte aus dem Material eines sehr alten Scheunentores besteht. Es ist sorgfältig bearbeitet. Eine Glasplatte, deckt die Oberfläche ab und lässt Maserung, Riefen und andere Zeitspuren sichtbar bleiben.
Diese rustikale Einrichtung steht in Kontrast zu den schräg geneigten gläsernen Außenwänden, die im Winkel von etwa einhundertundzwanzig Grad zueinanderstehen. Dadurch ist der trapezförmige Raum den ganzen Tag von Licht durchflutet. Die im Seitenbereich freistehende, moderne Rechner- und Medienwand mit groß dimensionierten Flachbildschirmen und mannshohen Lautsprecherboxen bietet hervorragende Voraussetzungen für Präsentationen, Filmdarbietungen und Fernsehübertragungen. Damit wird der Kontrast zur übrigen rustikalen Gestaltung zusätzlich verstärkt. Aus diesem Grund trägt dieser Raum auf dem „Olymp“ den Spitznamen „Glasscheune“. Man hat ein Buffet mit kleinen Appetithäppchen, diverse Säfte, Weinflaschen in Kühlbehältern und Gläser bereitgestellt.
Jerôme schaut auf seine Uhr. Er ist um fünf Minuten verspätet. Das ist ihm unangenehm, da Pünktlichkeit hier als oberstes Gebot gilt.
Berlin, Mittwoch, 18. Mai
Hanna Buskow befindet sich auf dem Weg zur Arbeit. Es ist 12:30 Uhr. Eigentlich beginnt die Arbeit erst um 14:00 Uhr. Aber immer, wenn sie zur Spätschicht eingeteilt ist, fährt sie etwas früher zum Dienst, um in der Kantine in Ruhe Mittag zu essen. Das Kantinenessen ist gut und preiswert und entlastet sie vom regelmäßigen Kochen in ihrem Singlehaushalt.
Im Abteil der U-Bahn befinden sich zu dieser Zeit nur wenige Fahrgäste. Erst am Umsteigebahnhof „Berliner Straße“ werden erheblich mehr hinzukommen.
Das monotone Rattern des Zuges lässt Hannas Gedanken, Erinnerungen und Bilder ohne Anstrengung wie verschüttete Flüssigkeit frei in alle Richtungen fließen. Sie bewegen sich von der Gegenwart in die Vergangenheit, von dort in die Zukunft und kehren zurück in die Gegenwart.
Das, was um sie herum geschieht, registriert sie unbeteiligt mit großem Abstand, wie durch ein Fernglas. Wenn der Zug in die Stationen fährt, bremst und anhält, reißt sie das aus diesem Gedankenfluss und zwingt sie zum Gleichgewichthalten, um das sanfte Nachvorngeschobenwerden abzufangen. Dieser Zug gehört noch zu den älteren Modellen, bestehend aus mehreren Einzelwaggons. Hanna mag diese Bauart lieber als jene Neuen, die man der ganzen Länge nach durchqueren kann und deren Schlangenbewegung bei der Kurvenfahrt zu sehen ist. Das abgeschlossene Abteil gibt ihr ein Gefühl größerer Geborgenheit und Übersichtlichkeit.
An der Station „Friedrich-Wilhelm-Platz“ steigt ein Gitarrenspieler ein. Sein Spiel und Gesang sind hervorragend. Nach zwei Stationen, kurz vor Einfahrt in den Bahnhof, ist die musikalische Darbietung beendet. Bevor der Zug anhält geht er mit einem Pappbecher durch das Abteil. Einige Fahrgäste spenden ein paar Münzen. Als er an Hanna vorbeigeht, zögert sie einen Moment lang. Sie hat sich fest vorgenommen, keinem der Musiker oder Zeitungsverkäufer in der U-Bahn eine Spende zu geben, weil sie dann nicht wüsste, bei wem sie aufhören sollte. Sie ist erleichtert, als er das Abteil verlässt, um im nächsten weiter zu spielen.
„ Wie kommt es, dass jemand, der so virtuos ein Musikinstru-
ment beherrscht, hier in der U-Bahn für ein paar Cents spielt ?“, wundert sie sich wieder einmal.
Obwohl nun einige Plätze frei geworden sind, zieht sie es vor, im hinteren Ausgangsbereich stehen zu bleiben. Sie muss ohnehin bald aussteigen.
Hanna denkt an ihre Arbeit. Es bewegen sie gemischte Gefühle. Sie war sehr froh und stolz, als ihre Bewerbung bei der Berliner Polizei angenommen wurde. Eigentlich war es ihr Ziel, nach dem Abitur Jura zu studieren, um Richterin oder Staatsanwältin zu werden. Sie hätte aber eine ziemlich lange Wartezeit auf einen Studienplatz in Kauf nehmen müssen. So entschloss sie sich für eine Ausbildung bei der Polizei. Dann wollte sie sehen, ob und wie es mit einem Studium an der Polizeiakademie weitergehen kann. Polizeiarbeit hatte sie schon immer interessiert, ein Faible, das niemand aus ihrer Familie und ihren Freunden so richtig verstand.
Dann war es soweit. Sie wurde zu einer nervenraubenden Einstellungsprozedur eingeladen. Der Intelligenztest und die anderen schriftlichen Aufgaben waren für sie ein Kinderspiel. Nur im sportlichen Teil der Prüfung wurde es eng, aber zum Schluss reichte es dann irgendwie doch. Dieses „Irgendwie-doch“ berührt in Hanna ein altes Problem und ruft die Frage hervor, die sie sich schon in der Schulzeit gestellt hatte und auch heute noch stellt, nämlich, in wieweit sich ihre Erfolge auf ihren Leistungen gründen und welche Rolle ihr Aussehen dabei spielt.
Читать дальше