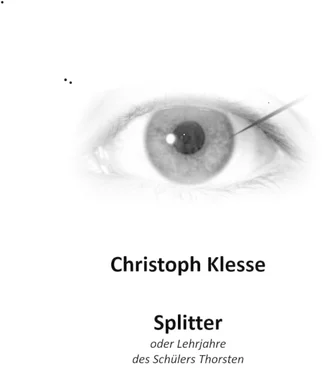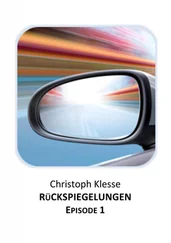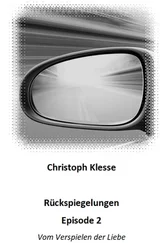Ich träumte. Ich lag am Ufer eines Sees, dessen Oberfläche in blauem Licht zitterte. Ich lag in weißem Sand, gehalten durch unsichtbare Fesseln. Dunkle Tannen umstanden den See, und über mir spannte sich ein sternenübersäter Himmel. Ein Licht strahlte auf, fuhr wie ein riesiger Finger auf das Wasser nieder, das sich teilte. Nach kurzer Zeit stieg aus der Flut eine Frau empor. In voller Anmut stand sie wie eine Perle in ihrer Muschel. Ein faltiges Gewand umfloss ihren Körper. In ihr Haar war ein Diadem geflochten. Ich wollte mich ihr nähern, aber verborgene Bänder hielten mich fest. Die Frau warf mir einen Schlüssel zu und versank. Die Welt schwand hin in einen kalten Nebel. Leere umgab mich, aber der Schlüssel blieb und bleibt mir, bis ich die Tür dazu finde. Ich nehme ihn mit mir in den morgendlichen Tag. Es bleiben Warten und Hoffen und die Frage: „Was ist hinter der Tür?“
Anmerkung: Zur Abwechslung eine romantische Phase!
Der Weg ist weit, die Straße, die mich zu Gott führen soll und zu dem, was ich sein kann, sie nimmt kein Ende.
Eine meiner besseren Eigenschaften ist Wissbegier. Zwar ist diese eine abgemilderte Form von Habgier, aber immerhin eine halbwegs positive Form.
Gott ist mir gnädig. Im Großen und Ganzen mache ich Fortschritte. Vor allem fühle ich mich wesentlich sicherer als noch vor ein paar Wochen. Mein Hang zur Selbstkritik hat sich in eine halbwegs vernünftige Richtung entwickelt. Jede Handlung kurz kritisieren, sobald sie abgeschlossen ist. Eine rasche Überlegung anstellen, wie ich es hätte besser machen können. Die Ursachen von Versagen kurz reflektieren, aber ohne Leidenschaft, ohne Selbstverachtung. Ruhe und Gleichmut sind eingezogen. Ich hoffe mal, dass mir darüber die Leidenschaft nicht ganz abhandenkommt.
Ein Loblied auf die Schule, der man doch mehr verdankt, als man zunächst glauben möchte. Sie hält den in ihre Maschinerie Eingespannten so beschäftigt, dass er gar nicht an Langeweile denken kann. In den Ferien hat man unversehens viel Zeit für das, was man während der Schulzeit gerne gemacht hätte, aber nun fehlt etwas, nämlich der ununterbrochene Kontakt zu anderen Menschen, die unablässige Auseinandersetzung mit ihnen. Gleich wird man träge und faul. Gott sei Dank sind die Ferien noch nicht zu Ende
Erstaunlich ist, was sich soeben zugetragen hat. Man sollte nicht glauben, dass man eine Schwester dreizehn Jahre lang in unmittelbarer Nähe hat, und sich dann so täuschen kann, wie es mir jetzt passierte. Schrieb ich also einen Brief an Thomas Fritsch, beklagte meine Schwester, die in ihn verknallt sei und bat ihn, ihr doch einen Brief zu schicken. Sie würde sonst sicherlich erkranken. Ich marschierte dann, stolz auf mein Werk, ins Wohnzimmer, wo meine Schwester am Fernseher saß, und verlangte eine Briefmarke. Wie erwartet hatte meine Schwester keine. Also musste ich auf den Markenvorrat der Eltern zurückgreifen, da ich keine passenden Geldstücke für den Briefmarkenautomaten hatte. Die Eltern waren übrigens im Theater, die Oma in Maxdorf. Ich legte meinen Brief wie absichtslos im Flur ab, so dass ihn meine Schwester sehen musste und verzog mich, als ob ich ihn vergessen hätte, in die Küche. Die Fernsehsendung, die sich meine Schwester ansah, ging zu Ende. Sie schaltete den Apparat aus, löschte das Licht und fand auf dem Weg zu ihrem Zimmer den Brief. Offenbar hatte sie ihn gelesen, denn er steckte danach umgekehrt im Kuvert. Als ich hörte, dass meine Schwester die Treppen hinaufging, schlich ich in den Flur, um zu prüfen, ob mein Versuch Erfolg gehabt hatte. Meine Schwester war bereits in ihrem Zimmer verschwunden. Ich nahm meinen Brief, enttäuscht über das Ausbleiben einer Reaktion und tat, als ginge ich zum Briefkasten. Nach angemessener Zeit kehrte ich zurück. Meine Schwester saß im Wohnzimmer und suchte Pflaster für die Blasen an ihren Händen. Sie hatte sich die Blasen beim Tennisspielen zugezogen. Ich gab ihr, was sie brauchte, erwartete, dass sie den Brief erwähnen würde. Nichts geschah. Kein Wort fiel über den Brief. ihr Blick ließ weder Verärgerung noch Belustigung erkennen. Aus diesen Mädchen soll doch einer schlau werden. Bisweilen sind die oberflächlichsten Wesen, die man sich vorstellen kann, man denke nur an ihre Verehrung von Filmhelden, die Besessenheit mit ihrem Teint. Und doch sind sie andererseits hintergründig veranlagt und leicht verletzlich. Ich möchte wetten, dass der Brief meine Schwester berührt hat, wahrscheinlich sogar ziemlich heftig, und doch lässt sie sich nichts anmerken. Auf alle Fälle werde ich nun ein wachsames Auge auf sie haben und jedes Wort, das ich sage, sorgfältig erwägen. Ich werde versuchen, diesem Wesen als charmanter kluger großer Bruder zu erscheinen.
Vielleicht wird das mich der Lösung meines Problems mit Dorothe näherbringen.
Elf Seiten heute geschrieben. Das ist ein Rekord.
Wie wäre es, wenn ich mir ein persönliches Schriftbild zulegen würde? Es könnte jedenfalls nicht schaden, wenn ich meine Kinderschrift allmählich ablegen würde.
Ich sollte versuchen, einen Mittelweg zu finden, nicht zu persönlich, aber auch nicht unpersönlich. Die kleinen Buchstaben sollte ich nicht allzu sehr verkümmern lassen. Andererseits sollte ich mich nicht zu sehr an das gelernte Schulschema halten.
Sollte ich kleiner schreiben, oder vielleicht eher größer?
Man könnte die Schrift auch mehr nach rechts neigen. Aber nach links wäre wohl persönlicher, individueller.
Auf alle Fälle lässt sich eines sagen: Ich trage noch Möglichkeiten in mir. Es könnte aber auch angebracht sein, die alte Kinderschrift erst Mal beizubehalten und noch etwas zu warten, bevor ich auf eine endgültige persönliche Handschrift umschalte.
Im prallen Licht der Julisonne schwitzte stumm und verbissen ein großer gelber Briefkasten vor dem Eingang eines Lebensmittelgeschäfts. Seit Jahren stand er schon da, aufmerksam und unverdrossen. Er schluckte geduldig alle Briefe, die man durch seinen zahnlosen Mund einwarf, nachdem man seine Oberlippe angehoben hatte. Aufmerksam beobachtete er seine Umgebung, Tag für Tag. Eines schönen Tages aber überkam ihn Langeweile. Immer wieder sah er die gleichen Leute, dieselben stumpfen Gesichter. Und er hörte zum x-ten Mal das gleiche Gerede, nichtssagend und billig, und darüber verfiel er in Trübsal. Zwar schluckte er weiter gehorsam, was man ihm einwarf, aber er tat es mit Widerwillen. Er wünschte sich Beine und Arme, kurzum er wollte ein Mensch sein. Ihm war aber klar, dass kein Mensch, der bei klarem Verstand war, mit ihm tauschen würde. Die Julisonne strahlte vom Himmel. Die Luft war schwer, bewegte sich träge. Ein junger Mann stieg vom Fahrrad, kaufte in dem Laden eine Flasche Bier und lehnte sich an den Briefkasten. Von Zeit zu Zeit nahm er einen Schluck aus der Flasche, wie es schien widerwillig. Ansonsten blinzelte er trübsinnig in den Himmel. „Man sollte ein Briefkasten sein. Dann hätte man wenigstens Ruhe, keine Sorgen mehr, nicht diese lästige Arbeit. Man wäre glücklich, wenigstens glücklicher als ich es jetzt bin“, seufzte er. „Wollen wir tauschen?“ fragte aufgeregt der Briefkasten, der so plötzlich die Erfüllung seines sehnlichen Wunsches in greifbare Nähe gerückt sah. „Gern“, sagte der junge Mann und beide tauschten ihre Animas. Der Briefkasten bereute den Tausch bald, denn früher hatte er das Gleiche immer wieder sehen und hören müssen. Nun musste aber auch Tagaus tagein das Gleiche tun. Von Tag zu Tag fühlte er sich leerer und trauriger. Nicht einmal Briefe durfte er noch schlucken und heimlich lesen. Gern hätte er seine alte gelbe Anima wieder eingetauscht. Doch der junge Mann hatte die Anima, die der Briefkasten ihm überlassen hatte, verloren, oder sie war ihm gestohlen worden. So musste der Briefkasten bis zu seinem Ende Mensch bleiben. Die Moral von der Geschichte aufzuzeigen erübrigt sich.
Читать дальше