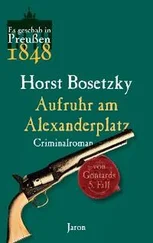„Eine Wüstung also“, ergriff ich das Wort.
„Ja, sie wissen vermutlich, dass es verschiedene Gründe dafür gab, warum Menschen ihr Siedlungsgebiet verlassen mussten.“
„Klar, Klimaveränderungen, Seuchen, feudale Landnahme, Kriege.“
„Und, was schätzen Sie, war hier der Grund dafür, dass die Bauern Loynmitte verlassen haben?“
„Nun, das wissen wir noch nicht. Fakt ist immer noch der Streit zwischen den Wetzlarern und den Solmsern.“
Ich wollte jetzt nicht weiter nachfragen, müsste ich dann doch über das berichten, was ich über die Situation in Wetzlar seinerzeit in Erfahrung gebracht hatte, müsste ihr auch meine Schlussfolgerungen im Hinblick auf die hiesigen Wüstungsursachen darlegen. Das wollte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht tun. Warum ich das nicht wollte, war mir selbst nicht klar. Vielleicht, weil ich bisher noch nicht genügend Belege für meine Vermutungen hatte. Und außerdem wollte ich ja keine historische Abhandlung, sondern eine Kurzgeschichte schreiben, deren Handlung von mir frei erfunden war.
Eines wusste ich aber schon jetzt, ich würde auch über mich selbst, über mein Leben, über meine Forschungsarbeit und natürlich auch über sie, die Archäologiestudentin schreiben. Also musste ich jetzt damit rausrücken, dass ich sie mit besonderer Absicht fotografiert hatte. Das tat ich nun, ging aber dabei ganz vorsichtig vor. Ich bemerkte, dass alles noch nicht entschieden sei und so.
„Zeigen Sie das Bild her!“ meinte sie in einem Ton, der nichts Gutes erahnen ließ.
Ich zog mein Smartphone aus der Tasche, öffnete die „Galerie“ und hielt ihr das Gerät hin, Protest erwartend. Sie nahm mir das Handy aus der Hand und betrachtete eingehend, was ich aufgenommen hatte.
„Das hier“, meinte sie, nachdem sie die Aufnahmen durchgesehen hatte, „da bin ich gut getroffen.“
„In Ordnung“, tat ich gleichgültig, das gefällt auch mir.“
„Ja, und welche Rolle kommt mir in der Geschichte zu?“
„Na, ist doch klar“, sagte ich, ohne zu überlegen,“ der Autor verliebt sich in die Studentin.“
„Rein fiktiv natürlich!“
„Aber ja, nur einmal so angenommen.“
„Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ich bekomme sie doch hoffentlich zuerst zu lesen?“
„Aber ja, selbstredend.“
Es entstand eine Pause, eine Verlegenheitspause. Rajna blickte zum Himmel und ich registrierte plötzlich, dass Wind aufgekommen war.
„Wenn das mal kein Gewitter gibt“, meinte sie.“ Besser wir decken den Rest der Grundmauern ab, die müssen vor Wasser geschützt werden.“
Rajna stand auf, legte ihre Sachen jenseits der Mauer ab und wies mit der Hand auf die große Plane, die zum Abdecken bereitlag. Der erste Blitz und kurz darauf der Donner, wie aus heiterem Himmel. Die Plane war aufgelegt. Rajna bedeutete mir, es ihr gleich zu tun und Steine zur Befestigung auszulegen. Die ersten Tropfen, und ehe wir uns versahen, entlud sich der Himmel, Donner folgte auf Blitz.
Etwa einhundert Meter waren es bis zum Bauwagen. Wir rannten los, blieben aber etwa nach der Hälfte des Weges stehen und sahen uns an, lachend.
„Jetzt sind wir eh nass,“ meinte sie und ging mir gemächlich voraus. Da auch meine Klamotten bereits durchnässt waren, folgte ich ihr in gleicher Weise. Im Bauwagen standen wir uns unschlüssig gegenüber.
„Wollen Sie warten, bis das Gewitter vorüber ist und dann gehen?“
„Wenn Sie nichts dagegen haben?“
„Nein, aber drehen Sie sich bitte um, ich will mir trockene Sachen anziehen.“
Ich tat, wie mir geheißen. An den Spiegel an der Wand des Bauwagens hatte sie wohl nicht gedacht, oder? Denn - plötzlich trafen sich dort unsere Blicke für einen Augenblick. Sie lächelte, äußerte sich aber nicht weiter. Umgezogen öffnete sie mir die Tür und blickte hinaus.
„Es hat aufgehört zu regnen, schauen Sie doch wieder einmal vorbei!“ „Bestimmt“, sagte ich und machte mich auf den Weg.
Was ich gesehen hatte, verfolgte mich, erschien mir in der Nacht im Traum. Doch wie es mit den Träumen so ist, wenn es schön wird, gehen sie zu Ende.
Tags darauf begab ich mich auf die Obstwiese hinter dem Grundstück meines Vermieters, dorthin, wo ich die Siedlung vermutete. Ich setzte mich auf eine Bank, die am Weg stand, und versuchte, mir vorzustellen, wie sie gelebt haben, die Menschen, hier vor 700 Jahren. Bestimmte Personen hatte ich dabei nicht vor Augen. Zunächst verschaffte ich mir einen allgemeinen Überblick.
Um diese Zeit waren die meisten Menschen Bauern. Sie lebten in Nachbarschaft und halfen einander. Sie bildeten eine Dorfgemeinde. Aus ihrer Mitte wählten sie den Vorsteher. Das war der Schulze. Der das Dorf umgebende Wald, das Weideland, die Teiche und Bäche gehörten allen gemeinsam. Das war die Allmende. Alle Dorfbewohner durften im Wald jagen und Holzfällen. Jeder konnte im Teich oder in den Bächen fischen. Man trieb die Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine auf die Dorfweiden und Waldwiesen. Inmitten der Allmende lag das Ackerland. Die Bauern oder ihre Vorfahren hatten es in gemeinsamer Arbeit urbar gemacht und bestellt. Von diesem Ackerland sprach die Dorfgemeinde jedem Bauern einen Teil zu. Diese Felder gehörten ihm, ebenso das Stück Land, auf dem sein Haus stand oder sich der Hof befand. Gäbe es da nicht die Kriege, die sich die Fürsten lieferten, wäre alles in schönster Ordnung gewesen. An diesen Kriegszügen, die fern ihrer Heimat stattfanden, mussten auch die Bauern teilnehmen. Der Befehl dazu kam vom Fürsten. So mussten die Bauern über Monate hinweg ihren Höfen fernbleiben. Mit der Arbeit auf den Feldern plagten sich dann die Frauen, Kinder und alten Leute. Oft blieb Arbeit unverrichtet. Wenn gar der Bauer mehrere Jahre hintereinander in den Krieg ziehen musste, war es um die Familie und den Hof in der Heimat schlimm bestellt. Wer aber dem Befehl zum Kriegsdienst nicht folgte oder wer ohne Erlaubnis das Heer verließ, erhielt eine hohe Strafe. Die Fürsten boten den Bauern an, den Kriegsdienst mit ihren bewaffneten Kriegern zu übernehmen. Doch jeder Fürst forderte dafür von den Bauern eine Gegenleistung. Künftig sollte das Ackerland der Bauern dem Herrn gehören. Zwar durfte ein Bauer auch weiterhin darauf wirtschaften, musste jedoch einen Teil seiner Ernte seinem Herrn als Abgabe erbringen. Außerdem musste er für den Herrn arbeiten, meist auf dessen Feld. Dies nannte man fronen und die Dienste Frondienste. Der Bauer musste seinem Herrn, dem Feudalherrn, gehorchen. Er war von nun an ein höriger Bauer.
Wenn durch Dürre oder Unwetter ein Teil der Ernte vernichtet wurde, erging es den Bauern schlecht. Dann mussten sie zum Beispiel zerriebene Eicheln oder Baumrinde ins Mehl mischen, um Brot backen zu können. Half der Feudalherr mit seinen Vorräten, also mit den zuvor erpressten Abgaben aus, verlangte er, dass der hörige Bauer ihm dafür seine Felder übereignete.
So wurden schon damals die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher. An dieser Stelle meiner Überlegungen fiel mir das folgende Gedicht von Bertolt Brecht ein: Reicher Mann und armer Mann standen da und sahn sich an. Und der Arme sagte bleich: „Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“
Mein Blick ging über die Wiese und die alten Obstbäume, die jetzt hier wuchsen, und doch konnte ich mir, als ich meine Augen schloss, vorstellen wie Menschen hier lebten, arbeiteten und liebten.
„Es hat aufgehört zu regnen, schauen Sie doch wieder einmal vorbei!“
Das waren ihre letzten Worte gewesen, und ich hatte geantwortet: „Bestimmt!“
Kommt nicht jeder gebundene Mann irgendwann mal in die Lage, von etwas, von jemandem, von einer Frau gepackt zu sein, wobei jede Vernunft in die Brüche geht, ging es mir durch den Kopf. Wie sieht es dann aus, mit seinen moralischen Bedenken, wenn er zu Hause eine Partnerin hat, die er um keinen Preis verlieren will. Oft schon hatte ich davon gelesen, wie es diesen Mann fortzieht und der Kopf an einer Ausrede tüftelt, um unbeobachtet das Handy zu nutzen. Trostworte, Schwüre, Vertröstungen und dann zurück an den häuslichen Tisch, ins Bett, auch das gehört dazu, während die Gedanken woanders sind. Recht üppige Gedanken, zumindest eine Zeit lang, weil es dort anders ist, neu, näher oder ferner der Arbeit, ein Abenteuer und mehr, manchmal viel mehr.
Читать дальше