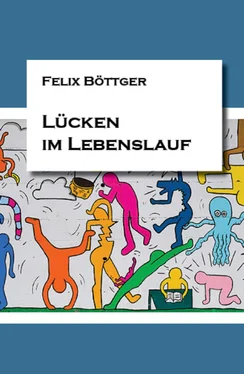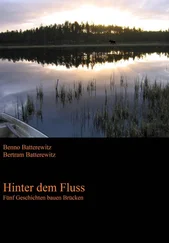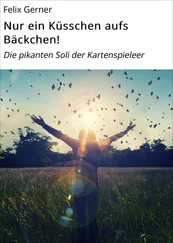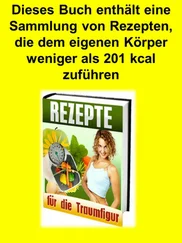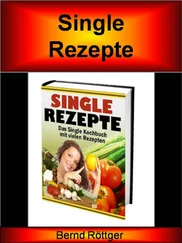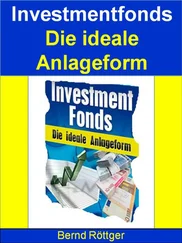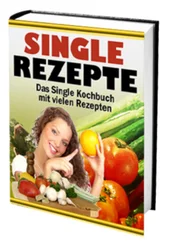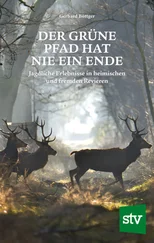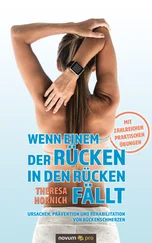Mit sechs Jahren und fünf Monaten wurde Maxim eingeschult. Anfangs entwickelte er durchaus Neugierde auf das, was ihm dort erzählt wurde. Insbesondere Lesen und Schreiben lernte er gerne, weil ihm dies die Möglichkeit eröffnete, Geschichten und Gedanken anderer Menschen zu entdecken. Hinzu kam ein gewisser sportlicher Ehrgeiz, der durch die permanente Abbildung seines Leistungsstandes – zunächst in Form lachender und weinender Smileys, später durch Ziffern von 1 bis 6 – befeuert wurde. So kam es, dass Maxim im zweiten Schuljahr einen Notenschnitt von 1,2 errang und diesen im dritten Schuljahr immerhin bei 1,3 halten konnte. Maxims Sozialverhalten allerdings war nach wie vor Gegenstand der Gespräche, die seine besorgten Lehrer mit seinen ihn liebenden Eltern auf den allgemeiner Besorgnis gewidmeten Elternsprechtagen führten. „Maxims Sozialkompetenz gibt Anlass zur Besorgnis“ hatte seine Klassenlehrerin in das sich sorgenfaltengleich kräuselnde Jahreszeugnis geschrieben, wonach sich eine mit gut gemeinten Worten drohende Prognose anschloss: „Seine mangelhafte Fähigkeit, sich in die Klassengemeinschaft zu integrieren, könnte sich auf Maxims schulische und langfristig auch berufliche Wettbewerbsfähigkeit auswirken.“
Um letztere nicht zu gefährden, reichte offenbar die Gruppentherapie nicht aus. Zum großen Glück für die Eltern bot die Schule im Rahmen einer Projektwoche ein Sozialkompetenztraining an, das sich an die gesamte Klassengemeinschaft richtete, vom „We love Life“-Sozialkompetenztrainingsstab zertifiziert und von Maxims Grundschule bedarfsorientiert weiterentwickelt worden war. Hier lernten die Schüler in sechs Modulen – von Rollenspielen über Entspannungsübungen bis hin zu Gruppendiskussionen –, wie sie die zunehmend komplexeren Herausforderungen des schulischen und nichtschulischen Alltags besser bewältigen konnten. Danach erhielt Maxim eine Urkunde, mit der ihm Freddy, der pinke „We love Life“-Kompetenzameisenbär, fröhlich lachend bescheinigte, seine Sozialkompetenz signifikant verbessert zu haben.
Leider schien dies eine Fehleinschätzung seitens Freddy gewesen zu sein, denn Maxim blieb weiterhin der eigenbrötlerische Außenseiter mit wenig Interesse an sozialen Interaktionen, Rangkämpfen innerhalb der Gruppe oder diversen Ballsportarten wie zuvor. Erstaunlicherweise wurde er aber auch kein Opfer von Hänseleien. Seine Mitschüler ließen ihn weitgehend in Ruhe, das Desinteresse schien also auf Gegenseitigkeit zu beruhen, was möglicherweise daran lag, dass Maxim nicht zu denjenigen gehörte, die im Grunde ihres Herzens liebend gerne eine größere Rolle in den gruppendynamischen Prozessen der Schülerzunft gespielt hätten und durch körperliche und/oder psychologische Defizite daran gehindert wurden. Nein, Maxim pflegte ein ehrliches und offenherziges Desinteresse daran, sich durch allgemein anerkannte Verhaltensweisen seinen Platz in der Rangordnung einer Gruppe gleichaltriger Kinder zu sichern. Doch Maxims aktives Desinteresse begann sich zur Besorgnis seiner Eltern zunehmend auch auf Lehrinhalte zu erstrecken. Sein Notenschnitt rutschte von 1,3 auf 1,4 im dritten und 1,6 im vierten Schuljahr ab. Damals hörte Maxim von seiner besorgten Klassenlehrerin zum ersten Mal den Satz, der ihn fortan sein ganzes Leben begleiten sollte: „Du könntest, wenn du wolltest, aber du willst nicht!“ Maxim wollte nicht.
Nichtwollen, selbst wenn dieses aus ganzem Herzen kam, schien zu jener Zeit ganz allgemein eine sehr verstörende Wirkung auf Menschen ausgeübt zu haben.
Es gab eine Zeit, da wäre ein Mann wie Philipp in seinem Beruf ein Kuriosum gewesen. Heute war er immerhin noch eine Ausnahmeerscheinung, die sich in einer sanft mahnenden, zugleich immer warnenden, jedoch nicht allzu strengen, oftmals nach Weichspüler duftenden, bisweilen weite Wollpullover tragenden (damit Übergewicht kaschierenden), kurzum weiblichen Welt behaupten musste. Philipps Berufswahl hatte ihn in eine Welt geführt, um die die meisten Männer in einer früheren Zeit stets einen großen Bogen gemacht hatten: die der Kindergärten.
Vielleicht hätte man zu einer längst verblichenen Zeit Philipp Neigungen unterstellt, die gesellschaftlich geächtet waren, zumindest hätte er sich für seinen Beruf rechtfertigen müssen. Nur bei einigen progressiv eingestellten Frauen hätte er bereits damals Anerkennung gefunden, ja vielleicht hätte ihm seine Berufswahl sogar einen Vorteil bei der Partnersuche verschafft – als Vorhut des neuen Mannes, der bereitwillig die Hälfte des Haushalts und der Kindererziehung übernimmt und sich als einziges Zugeständnis an seine Rest-Männlichkeit einen Dreitagebart wachsen lässt, der allen frischgebackenen Vätern einen ungeahnten Sexappeal zu verleihen vermag, vermöge des herzergreifenden Kontrastes zwischen bärtiger Stoppeligkeit und rosiger Haut des Neugeborenen, das beim Einkaufen verschlafen aus dem über die männliche Brust geschnallten Tragegurt herausschaut und nicht ahnt, dass alle jüngeren Frauen in Papas Umgebung dahinschmelzen angesichts dieser Zurschaustellung mütterlicher Männlichkeit.
Doch es wäre zu viel gesagt, wenn man Philipps Beruf als seinen Traumberuf bezeichnen würde. Vor zehn Jahren, zu Beginn seines Studiums, wäre Philipp die Vorstellung, seinen derzeitigen Beruf auszuüben, wie eine Niederlage vorgekommen, wie eine Verhöhnung seines Lebensweges, seiner Begabung, seiner Träume und Ambitionen. Heute empfand er morgens, wenn er sich auf den Weg zur Arbeit machte, vor allem eines: Dankbarkeit.
Philipp hatte Sprachwissenschaft und Ethnologie studiert, hauptsächlich weil er nach dem Abitur wie so viele seiner Altersgenossen nicht die geringste Ahnung hatte, was er später beruflich machen wollte. Seine Eltern, ein Lehrerehepaar, ließen ihm da gänzlich freie Wahl, und weil Philipp zwar studieren, aber auf keinen Fall das Gleiche wie seine Eltern machen wollte, wusste er nur, dass für ihn ein Lehramtsstudium nicht infrage kam. Philipp hatte eine gewisse sprachliche Begabung und interessierte sich für Bücher, insofern wäre ein Germanistikstudium in die engere Auswahl gekommen. Gleichzeitig spürte er eine abstrakte Sehnsucht nach Abenteuern und fremden Kulturen, zumindest las er gerne darüber, und nach der Lektüre einiger populärwissenschaftlicher Sachbücher des amerikanischen Anthropologen Jared Diamond vergnügte er sich mit Tagträumen, in denen er sich in einer zeitlich nicht genau eingegrenzten Zukunft in irgendeinem nicht näher lokalisierbaren Inselstaat als Ethnologe mit der Machete durch den Dschungel schlug, um zurück am heimischen Schreibtisch (den er sich trotz Digitalisierung und IKEAlisierung aus robustem, dunkelbraunen Holz vorstellte, auf dem zahlreiche mit Kugelschreiber oder noch besser Tintenfüller vollgekritzelte Papierblätter herumlagen) mit der sprachwissenschaftlichen Schärfe seiner Analysen eine Schneise der Erkenntnis durch das Gebrabbel bislang ungehörter Stimmen zu öffnen.
In Philipps Imagination vereinte der Beruf des Ethnologen zwei Welten: einerseits die wissenschaftliche Strenge und andererseits den süßen Geruch nach Abenteuer, dessen Verlockungen Philipp bereits seit Kindesbeinen an, unter anderem durch den Konsum etlicher Star-Trek-Folgen, erlegen war. Anders als viele seiner Kommilitonen, die BWL, Jura oder ein sonstiges, allein auf spätere finanzielle Einkünfte ausgerichtetes Fach studierten, war Philipp ein begeisterter Student. Zu seinem Bedauern jedoch war auch das Studium der Sprachwissenschaft und Ethnologie von den Reformen durch Bologna 2.0 nicht verschont geblieben, was bedeutete, dass das althergebrachte Creditpointsystem durch ein Level- und Checkpointsystem ergänzt worden war, zu denen sich später mit Bologna 2.1 sogenannte Achievements hinzugesellten, die für bestimmte Extraleistungen („Erreiche bei der nächsten Klausur 10 Prozent mehr Punkte als dein Sitznachbar“) verliehen wurden. Allerdings hatten sich die Dozenten in Philipps Fachbereich eine, wie sie es selber nannten, „kritische Distanz“ zur allgegenwärtigen Gamifizierung der Studienwelt bewahrt und stellten dieser die „Freiheit von Lehre und Studium“ entgegen, wobei sie ihre Studenten gerade deshalb besonders wertschätzen, weil selbige bei der Wahl ihres Studienfachs von beruflichen Ambitionen abgesehen hatten (ansonsten wäre die Fächerwahl wohl anders ausgefallen).
Читать дальше