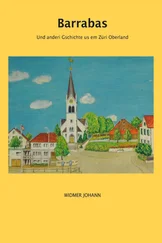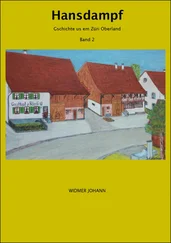Auch der Moses hatte mir imponiert mit seinen Zaubertricks, aber ich kannte noch einen Zauberer persönlich, er nannte sich Rico Peter und zog von Dorf zu Dorf und zeigte seine Zaubertricks mit Karten oder mit seinem Zylinderhut voller Tauben und Kaninchen. Ja, von dem hätte Moses noch einiges lernen können. Am Nachmittag vor der Vorstellung bezahlte mir der Zauberkünstler ein „Vivikola“ in der Gartenwirtschaft und zeigte mir ein paar einfache Tricks mit zwei weissen Seilen und dann redeten wir noch lange über die Leute des Dorfes. Ich gab ihm genaue Beschreibungen bestimmter Personen, verriet ihm verschwiegene Dorf– und Familiengeheimnisse. Da er Gedankenleser war, hätte er meine Angaben eigentlich nicht gebraucht, aber er wollte anscheinend auf Nummer Sicher gehen. Nach einer weiteren Flasche Kola schenkte er mir noch Freikarten für unsere ganze Familie. Es wurde ein toller Abend, nur beim Kapitel Gedankenlesen stutzte ich einige Male, denn mir kam plötzlich die Idee … aber dann durfte ich sogar noch auf die Bühne und konnte ihm helfen, die zwei Kaninchen wieder einzufangen.
Am folgenden Tag verkündete ich vor einer grossen Kinderschar, dass Moses, im Vergleich mit Rico Peter ein kläglicher Stümper gewesen sei, denn wenn der Patriarch hätte Gedankenlesen können, wäre das mit dem goldenen Kalb gar nicht passiert.
Die meisten Kinder begriffen nicht, wovon ich redete nur Hugo begehrte auf und nannte mich einen gottverdammten reformierten Ketzer, den man steinigen müsste und dann schmiss er einen faustgrossen Stein nach mir.
Ich fand den „Ketzer“ nicht ehrenrührig, im Gegenteil, es war ein neues und interessantes Wort aber den Stein nahm ich ernst, obschon er weit danebengegangen war. Meine Murmel hingegen traf genau zwischen seine Augen.
Das nachfolgende Strafgericht wühlte wieder in den alten Geschichten von damals, als ich ihn hatte „totmachen“ wollen. Die zwei erzieherisch wertvollen Ohrfeigen gab ich ihm am folgenden Tag kommentarlos weiter. Ebenso wortlos händigte er mir den Ersatz für die verlorene Murmel aus.
Mein Leseeifer war für den Aufbau eines sozialen Netzes nicht besonders förderlich, das heisst, ich hatte während meiner Schulzeit eigentlich nie einen Freund, schon gar nicht eine Freundin, denn bei der damaligen Sittenstrenge und Bigotterie war ein solches Verhältnis unmöglich. Wenn nur schon ein leiser Verdacht aufkam, wurde man von Lehrern, Eltern und Pfarrherren derart ins Gebet genommen, dass man es lieber bleiben liess.
Ich hatte einmal ein Mädchen vor dem Lehrer in Schutz genommen, weil er sie vor der ganzen Klasse so richtig fertiggemacht hatte. Wir nannten sie alle nur die „doofe Emma“, weil sie kein Licht der Wissenschaft zu werden drohte, sondern eher das Gegenteil, aber dass sie das Bruchrechnen nicht begriff und ihr sogar das kleine Einmaleins fremd war und blieb, dafür konnte sie nun mal nichts, sie war zu blöd dafür.
Dass sie der Lehrer aber tagtäglich deswegen blossstellte, beschimpfte oder gar schlug, konnte mein fanatisches Gerechtigkeitsgefühl nicht ertragen (auch Emmas verzweifeltes Weinen und Schniefen machten mich fertig).
Als es einmal gar zu arg wurde, stand ich auf und sagte zum Lehrer er sollte sich schämen für sein gemeines Benehmen. Zur allgemeinen Freude und Belustigung der Klasse erhielt ich ein Dutzend Schläge mit der Rute auf den blossen Hintern.
Der Schmerz war erträglich, die Schande nicht, sie schrie nach Vergeltung.
Am folgenden Tag brachte mir Emma ein selbstgebackenes „Bauernbrot“ (aus Weissmehl, Milch und Eiern).
Das gab natürlich zu reden, denn nun war allen (auch dem Lehrer) klar, dass wir „etwas hatten miteinander“. Nun war ich das Ziel von Spott und Hohn, aber ich war der Situation gewachsen.
Leider war es das letzte Kuchenbrot das ich von Emma erhalten hatte, denn sie wurde auf das Drängen ihrer Eltern schon wenige Tage später in eine andere Schule im Nachbardorf versetzt.
Kurz nach dem Krieg hatte der Nachbar einen neuen Knecht, einen bärenstarken Kerl, der auf seinem Kraushaar immer eine grüne Baskenmütze trug und seine Füsse steckten in Schaftstiefeln, wie sie von den Fallschirmspringern getragen wurden.
Vom ersten Tag an zeigte man ihm deutlich, dass er hier unwillkommen war, weil er direkt aus dem Gefängnis gekommen war. Das heisst, er kam vom „Zugerberg“, das war eine Strafkolonie der Schweizer Armee für „Landesverräter“. Das Militärgericht hatte ihn verurteilt, weil er in fremden Diensten gestanden hatte, er hatte in der Fremdenlegion gedient. Uns Kindern war der Umgang mit ihm strengstens verboten.
Ich beobachtete ihn eine Zeit lang und stellte dabei fest, dass er wohl kein Teufel in Menschengestalt sei, denn er war stets vergnügt bei seiner Arbeit und konnte laut und herzlich lachen. Ich mag Menschen, die lachen können, die anderen machen mir Angst.
Er heisse Jacques, stellte er sich mir vor, das töne viel besser als unser „Köbi“, sei aber dasselbe, einfach französisch. Der Typ gefiel mir. Er war stark, konnte arbeiten wie ein Pferd und wurde dabei scheinbar nie müde. Vor allem konnte er erzählen, denn er hatte einiges erlebt. Was ich aber am Anfang nicht gemerkt hatte, war seine grosse Liebe zum Alkohol. Zum Essen trank er Most (er sagte „cidre“) wie alle anderen, vielleicht ein paar Schlucke mehr, aber in der Zwischenzeit nahm er regelmässig einen Schluck aus seinem „Flachmann“ oder seiner „Wanze“ wie wir diese flachen Schnapsflaschen nennen, die so gut in die Rocktasche passen.
Am Abend, wenn die Stallarbeit beendet war, setzten wir uns auf die Bank vor dem Haus und Jacques erzählte von seinen Abenteuern in Indochina. Dabei hatte er nicht nur Krieg erlebt, er hatte fremdländische Tropenfrüchte gegessen, hatte schwitzend und keuchend den Dschungel durchquert, hatte Durst gelitten, hatte einen gefährlichen Tiger erlegt, war auf Elefanten geritten, war mit seinem Fallschirm in einem Baum hängengeblieben und hatte gute Kameradschaft erlebt.
Von Krieg und Schlachtengetümmel erzählte er wenig und wenn, dann offensichtlich ungern. Er meinte einmal, es gebe im Prinzip zwei Arten von Krieg, der schmutzige Krieg und der noch schmutzigere.
Oder einmal meinte er, die Soldaten seien keine Mörder sondern Opfer, Mörder seien jene, die den Krieg anzetteln und daran verdienten.
Meine Eltern sahen es nicht gerne wenn ich mit ihm zusammen war, sie befürchteten nämlich, dass er mir „einen Floh ins Ohr setzen werde“ mit seinen Schwärmereien von der Legion, die mich aber weit weniger lockte als fremde Welten, Dschungel, Tiger, andere Völker und ihre Kultur.
Leider waren das seltene Abende an denen er erzählte, meist zog es ihn ins Wirtshaus zu Bier und Schnaps, zu seinem Stumpen und zu Seline, der Kellnerin. Manchmal blieb er bei ihr bis zum Morgengrauen, aber meistens endete seine Sauftour mit einer handfesten Schlägerei. Seine Widersacher, alles junge Burschen aus dem Dorf, fielen oft zu dritt oder zu viert über ihn her, aber sie zogen immer schmählich den Kürzeren, denn Jacques war eine, im Nahkampf gut ausgebildete Mordmaschine, die er zum Glück für seine Gegner sicher beherrschte, so dass es immer ohne Totschlag ausging.
Aber der Schaden, den er anrichtete war trotzdem enorm. Der junge Bühl – Bauer verlor eine Ohrmuschel, ein Armbruch und zwei ausgekugelte Schultern gingen aufs Schadenkonto von Leuten aus dem Nachbardorf und schliesslich kam das gebrochene Nasenbein des Rössliwirtes noch dazu und führte zu einem generellen Wirtshausverbot für den Legionär in der ganzen Gemeinde.
Mir war das mehr als Recht, denn nun hatte er wieder mehr Zeit zum Erzählen.
Was mich nun auch interessierte war der Nahkampf, die Selbstverteidigung, denn ich war auch damals kein imposanter Muskelprotz und konnte mich bei tätlichen Auseinandersetzungen nur schwer behaupten, wenn überhaupt.
Читать дальше