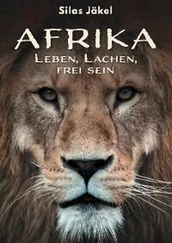Ich nahm ganz selbstverständlich das Auto, kaufte auf dem Rückweg von der Uni ein, jobbte mittwochs und donnerstags von Mittag bis Ladenschluss in der Buchhandlung. Kam ich abends nach Hause, warteten ein warmes Essen auf mich und der Fernsehsessel. Hatte ich nachmittags frei, lernte oder las ich, auf dem Sofa liegend, oder surfte im Internet, während ich Thea irgendwo werkeln hörte. Sie war ständig beschäftigt, nie sah ich sie tagsüber ein Buch oder die Zeitung lesen.
Jeden Tag beim Essen fragte sie mich, was ich erlebt und erfahren hatte, wie ich Sachverhalte beurteilte, zu politischen und gesellschaftlichen Ereignissen stand. Ich wurde lockerer, selbstsicherer, offener.
Mit ihrer Hilfe bereitete ich ein Referat vor, das mir großen Beifall meiner Kommilitonen einbrachte und ein anerkennendes Nicken des Doktoranden, der das Seminar leitete. Ich ergriff öfter als noch im vergangenen Semester und in allen davor das Wort, beteiligte mich an Gesprächen und Debatten. Ich nahm mich einiger Erstsemester an, erklärte ihnen Abläufe, gab Tipps und Ratschläge. Dankbar luden sie mich auf ein Bier in die Kneipe zwei Querstraßen von der Uni entfernt ein. Ich lehnte ab.
Meine Mutter hatte mich spätestens zur Tagesschau erwartet. Verspätete ich mich, weil ein Dozent ein Abendseminar überzog oder sich an eine Lesung eine Diskussion anschloss, die mich fesselte, bekam ich Ärger.
Thea musste meine Unsicherheit, meinen inneren Konflikt gespürt haben, denn sie sprach mich eines Abends an: »Warum gehst du nicht mal weg? Such dir Freunde, geh ins Kino oder was auch immer junge Leute so tun. Ich kann dir nun wirklich kein Ersatz sein für Unterhaltungen mit deinesgleichen und Gleichaltrigen.«
»Das wird dann aber ziemlich spät. Ich meine, bis ich hier bin ... Der Zug fährt nachts nur noch stündlich«, glaubte ich, mich verteidigen zu müssen.
»Na und? Du bist doch kein Teenager mehr! Freitags einen draufmachen, tut man das nicht als Student?« Sie nickte mir aufmunternd zu.
»Vermutlich«, murmelte ich.
»Gib einfach Bescheid, ruf kurz an, dann weiß ich, dass ich nicht auf dich warten muss.«
Damit war das Thema erledigt. Ein Dogma, das jahrelang Bestand gehabt hatte, war plötzlich keines mehr.
Ich schaute aus dem Fenster hinaus in die Abendröte und fühlte mich großartig. Ich war ... frei!
Mitte Dezember lernte ich ein Mädchen kennen. Eigentlich kannte ich sie schon länger, sie war mir bereits vor mehr als einem Jahr aufgefallen. Sie saß in den Vorlesungen meistens am selben Platz in der dritten Sitzreihe am Fenster. Ihr halblanges, blondes Haar strich sie mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks mit dem Daumen aus der Stirn.
Ich hatte mich nur ein einziges Mal mit ihr unterhalten, vor einigen Monaten. Es ging um ein Skript, das ich für sie kopieren sollte. Meine Notizen waren begehrt bei meinen Kommilitonen, denn ich schrieb nicht nur mit, sondern tippte meine Aufzeichnungen zu Hause ins Reine und versah sie mit Anmerkungen.
Sie hatte die gehefteten Blätter genommen, mir höflich gedankt, blendend weiße Zähne und ein Blitzen ihrer hellblauen Augen präsentiert. Dann war sie mit ihren Freundinnen in der Mensa untergetaucht.
Ich hatte ihr nachgeschaut.
Wie es sich ergab, dass ich beim Mittagessen neben ihr saß, weiß ich nicht mehr. Ich schaufelte Schnitzel mit Pommes in mich hinein, sie stocherte gedankenversunken in welkem Salat. Um uns herum Stimmengewirr.
Plötzlich sah sie mich an. »Was ist Dein Thema?«
Meine Gabel stoppte auf halber Höhe zum Mund. »Wie bitte?«
»Dein Thema. Für die Seminararbeit.«
»Ach so. Ich werde Stolzenberg analysieren.«
»Diesen Labersack. Blabla, mehr kann er nicht.«
»Wenn man ihn seine Texte vorlesen hört, beginnen sie zu leben«, verteidigte ich den Newcomer unter den Münchner Schriftstellern. Der Mittdreißiger hatte kurz hintereinander drei Bücher veröffentlicht, die polarisierten und in den Feuilletons ausführlich besprochen wurden. »Aber er hat einen sehr eigenen Stil, das gebe ich zu.«
»Laaangatmig. Schlimmer als Proust«, maulte sie.
Ich lachte. »Schlimmer als Proust geht nicht.«
Statt in die nächste Vorlesung gingen wir an diesem Tag in den Englischen Garten, spazierten am Eisbach entlang, tranken Kaffee. Wir redeten über Dichter und deren Werke, analysierten, interpretierten und stellten wilde Thesen zu Schriftstellern und deren Protagonisten auf.
»Schreibst du?«, fragte sie plötzlich.
»Hm. Nein. Ich verstehe was von Literatur, aber ich kann nicht schreiben. Ist das schlimm?«
»Nein, natürlich nicht. Aber das Handwerk des Schreibens, das solltest du lernen. Es hilft dir, wenn du nachvollziehen können willst, wie Texte entstehen, oder zu beurteilen hast, ob und wie sie zu verbessern sein könnten. Schreibst du nicht hin und wieder selbst, kennst du das Gefühl nicht, wenn die Story zu leben beginnt. Und den Frust, dass sie es nicht tut, obwohl du engagiert daran feilst. Auch das Verwerfen und Neuanfangen gehört zum Schreiben, verstehst du?«
Ich nickte nachdenklich.
»Am Wochenende findet ein Schreibworkshop statt«, insistierte sie. »Ich werde hingehen. Was ist mir dir? Es sind recht gute Autoren eingeladen, dazu ein paar Verlagsmenschen. Könnte interessant werden.«
»Wäre eine Überlegung wert. Weißt du Näheres? Wo es ist, was es kostet?«
»Irgendwo am Starnberger See, in einem Seminarzentrum. Man kann dort auch übernachten. Organisiert wird das Ganze von einer kirchlichen Organisation. Frag mich bitte nicht, welcher. Katholisch, denke ich. Es ist kostenlos für Studenten, man muss nur das Essen bezahlen. Hey, da juckt doch nicht, wer es veranstaltet, oder? Ich meine, solange ich nicht bekehrt werden soll?«
Sie warf den Kopf zurück, schloss die Augen, lachte. Ihre Haare leuchteten golden in der Sonne. Sie war wunderschön.
Wir brachen auf, als die Glocken der nahegelegenen Kirche viermal schlugen. Vorlesungsende. Gemeinsam schlenderten wir zur U-Bahn, wo wir uns verabschiedeten.
»Äh ... Wie heißt du eigentlich?«
»Jessica.«
»Christian.«
»Ich weiß.«
»Äh, na dann ... Man sieht sich.«
»Ja. Morgen.«
Wir fuhren zusammen nach Tutzing. Ich holte sie am Freitagnachmittag mit dem Wagen bei ihr zu Hause ab.
Sie lebte mit einer Freundin in einer Altbauwohnung im Westen Münchens. Die knarrenden Holzböden und hohen Stuckdecken strahlten Gemütlichkeit aus, ebenso wie die bunten Sitzkissen, die im Wohnzimmer verteilt waren. An den Wänden hingen Aquarelle und ein riesiger Flachbildschirm, von irgendwoher klang Musik. Didgeridoo. Im Treppenhaus ächzten ausgetretene Stufen und ein geschnitztes Geländer, Buntglasfenster machten ein surreales Licht.
Alles fühlte sich warm an, stimmte, harmonierte.
Thea freute sich darüber, dass ich Anschluss gefunden hatte, und erklärte, dass es ihr recht sei, einige Tage nicht kochen zu müssen und die Füße hochlegen zu können.
Dass es sich bei meiner Bekanntschaft um eine Frau handelte, erzählte ich nicht.
Читать дальше