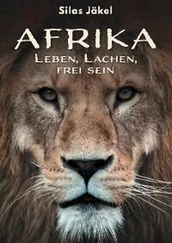Das Schlafzimmer meiner Eltern betrat ich nicht. Ich wusste, wie es dort aussah. Ein bis zur Decke reichender Schiebetürenschrank mit Spiegeln, ein Doppelbett, zwei Nachtkästchen mit Schirmlampen und auf Mutters Seite einem Wecker. Geblümte, ausgebleichte Bettwäsche.
In dem düsteren Flur mit Holzboden und Flickenteppich blieb ich stehen, lehnte mich an die Wand, schaute durch die offene Haustür nach draußen.
Ich hatte keine Ahnung, was ich anfangen sollte mit meinem Leben, diesem neuen Leben, das mir so unvermittelt geschenkt worden war.
Denn so, das gestand ich mir ein, empfand ich es.
So verging der Tag. Mein erster ... Ich stutzte. Mein erster Tag in Freiheit.
»Morgen wirst du frei sein.«
Hitze schoss mir ins Gesicht. Ich rannte ins Haus. Wo hatte ich nur die Post hingelegt? Da war er, der Stapel. Auf dem Esstisch. Ich fand den Zettel, nahm ihn, starrte ihn an. Meine Hand zitterte, die Schrift vor meinen Augen verschwamm.
Ich ließ mich auf einen Stuhl fallen.
Was, verdammt noch mal, bedeutete das? War ich paranoid? Oder ...
In dieser Nacht ging ich nicht ins Bett.
Ich hatte kein Geräusch gehört. Und doch war jemand im Haus gewesen.
Ein Blatt Papier lag auf der Schwelle zum Wohnzimmer, dem Raum, in dem ich die Nacht verbracht hatte. Einen Moment hoffte ich, dass die Nachricht, die ich unzählige Male gedreht, gewendet und gefaltet hatte und über der ich, den Kopf auf dem Tisch, eingeschlafen war, zu Boden gefallen und zur Tür gerutscht war.
Doch sie lag vor mir.
»Freiheit gibt es nicht umsonst«, las ich, als ich mich so weit beruhigt hatte, um aufzustehen, den Zettel aufzuheben und umzudrehen.
Die Schrift, diese gewissenhaft gemalten Buchstaben, kannte ich. Den Stift, mit dem diese Worte geschrieben worden waren und der auf dem Papier lag, ebenfalls. Es war mein eigener. Ich steckte ihn in die Hosentasche.
Die Haustüre war unversperrt. Natürlich war sie das, denn Mutter, die bisher dafür Sorge getragen hatte, dass das Haus abends einbruchsicher verrammelt wurde, lag im Moor. Vor der Tür war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Was hätte da auch sein sollen? Die Person, der mir Nachrichten zukommen ließ? Sie würde wohl kaum auf mich warten und mir Rede und Antwort stehen, schalt ich mich selbst.
Aber was bedeuteten diese Sätze? Ich wagte nur zögernd, ihren Sinn zu verstehen.
Es ging um Freiheit. Um meine Freiheit, wie es schien. Und damit um den Tod meiner Mutter, zwangsläufig.
Hatte es einen Zeugen gegeben? Der mich mit seinem Wissen erpresste? Es sah so aus.
Doch was war bei mir zu holen? Vermögen hatte ich nicht. Ich erhielt Bafög, ein paar hundert Euro im Monat, und eine bescheidene Waisenrente. Dazu das Geld, das ich in der Buchhandlung verdiente. Genug, um die Fahrkarten nach München zu kaufen, hin und wieder Klamotten, Essensmarken für die Mensa und morgens am Hauptbahnhof Kaffee. Und Bücher natürlich.
Brauchte ich Fachliteratur, Zubehör für meinen Computer, Geld für Seminare oder den Eintritt zu Lesungen, musste ich an mein Sparbuch. Ein paar hundert Euro, mehr hatte ich nie zur Verfügung.
Was konnte ich einem Erpresser also anbieten? Ein Auto, Baujahr 1992, ein altes Haus, abgewohnte Möbel. Die Flinten meines Vaters. Würde das reichen?
Ich sollte es bald erfahren.
Um mich abzulenken, fuhr ich in die Stadt. Der Kühlschrank war leer, und ich hatte seit Tagen nichts anderes als Brot gegessen. In der Dose auf dem Küchenschrank hatte ich neben Briefmarken und Rabattgutscheinen Geld gefunden, das ich einsteckte.
Eier, Wurst und Käse lagen bereits in meinem Einkaufswagen. Ich schob ihn an der Fleischtheke vorbei zum Kühlregal, wo ich bei verschiedenen Pizzas zugriff. Auch bei den Nudeln und Saucengläsern bediente ich mich.
Kochen hatte ich nie richtig gelernt, obwohl ich als Jugendlicher intensives Interesse an der Zubereitung des von Vater Erlegten gezeigt hatte. Meine Mutter hatte sich jedoch jede Einmischung in ihrer Küche verbeten. Damit blieben mir Hilfstätigkeiten unter Aufsicht vorbehalten: Zwiebeln schneiden, Äpfel für Kuchen oder Kompott schälen, Kartoffeln raspeln, Geschirr spülen.
An der Kasse sprach mich eine Frau an: »Hallo Christian. Wie geht´s denn deiner Mutter?«
Ich zuckte zusammen.
»Ich hab sie ja ewig nicht gesehen«, plauderte sie, ohne auf eine Antwort zu warten. Dabei räumte sie den Inhalt ihres Einkaufswagens auf das Band. »Und du bist ja sicher bald mit dem Studium fertig, oder?«
»Äh ...«, stammelte ich. »Es ist schon noch ein Weilchen hin. Also, ein Jahr oder so.«
Die Frau schaute mir direkt ins Gesicht. Sie hatte hellgrüne Augen mit dunklem Rand. Ihr Blick war offen und intelligent. »Ach was.«
Ich war froh, mit dem Bezahlen an der Reihe zu sein und mich abwenden zu können. Diese Person machte mich nervös. Ich hielt der Kassiererin einen Fünfziger hin. Sie starrte mich fragend, fast wütend an.
»Ob du eine Tüte möchtest«, assistierte die Stimme in meinem Rücken.
»Ach so. Ja. Bitte. Äh ... Danke.«
Kopfschüttelnd warf die Kassiererin einen Plastikbeutel auf meinen Einkauf, riss den Schein aus meiner Faust. Sie hieb auf eine für mich nicht sichtbare Tastatur ein. Die Hand erschien wieder, warf Geld auf das Fließband. »Fuffzehneinundzwanzig zurück. Wiedersehen.«
Ich stopfte die Banknote und die Münzen achtlos in die Hosentasche, räumte Beutel, Packungen, Gläser in die Tüte und ergriff die Flucht.
Als ich im Auto saß, beruhigten sich mein Puls und meine Atmung allmählich.
Zufall. Ein ganz normales Gespräch an einem ganz normalen Tag in einem ganz normalen Laden.
Ich glaubte mir nicht.
Wo ich gewesen war, wusste ich nicht. Ich war gedankenversunken herumgefahren, bis die Tankanzeige zu leuchten begann. Dieses Gelb, das durch die zunehmende Dämmerung stach, schien mich aufzuwecken. Ich orientierte mich, schaltete das Licht an und bog ab, um auf einer schmalen Straße, nicht mehr als ein Feldweg, nach Hause zu fahren.
Jemand saß auf den Stufen vor dem Eingang, neben sich eine Einkaufstasche. An der Wand lehnte ein Damenfahrrad.
Langsam fuhr ich in den Hof, bremste, stellte den Motor ab, starrte durch die Windschutzscheibe.
Die Frau aus dem Supermarkt. Sie lächelte mich an.
Schweißtropfen rannen mir den Rücken hinab, als ich betont lässig ausstieg, meine Tüte von der Rückbank holte, die Wagentüren zuwarf und zum Haus ging.
»Na, wo bist du denn so lang gewesen?«
Ich blieb stehen. Meine Lockerheit fiel von mir ab. »Ei ... Einfach rumgefahren.«
Ich spürte, wie ich rot wurde, wollte die Augen senken, wegschauen, konnte ihrem Blick aber nicht ausweichen. Sie saß noch immer, den Rücken an die Tür gelehnt, hatte den Kopf gehoben, lächelte mich aufmunternd an.
»Na, dann wollen wir doch mal reingehen, oder?«
Sie stand auf, griff nach der Klinke, drückte sie. Öffnete die Tür. Ich hatte erneut vergessen, abzusperren.
Читать дальше