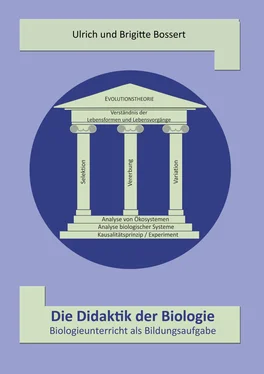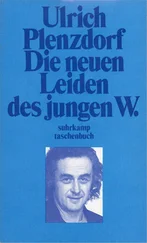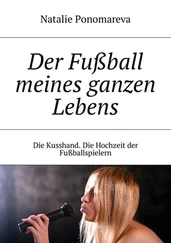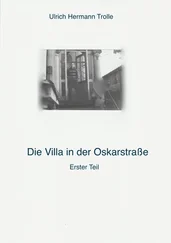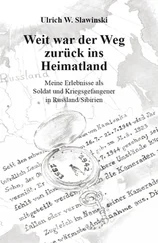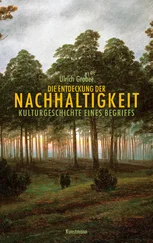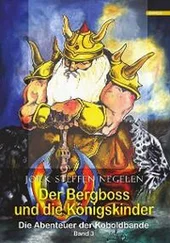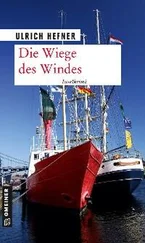Wir können auch aus Fehlern anderer Menschen lernen. Die Erfahrung und Beobachtung von anderen hilft uns bei Entscheidungen. Auch Roboter können durch die Interaktion mit ihrer Umwelt selbst Daten erzeugen und diese auswerten. Ihr Programm versucht dann vorherzusagen, was geschieht.
Wenn es keine "höchsten Werte" gibt und "der Mensch dazu verurteilt ist, frei zu sein", dann gibt es bei den Einschätzungen des Mitmenschen Unsicherheiten. Die Handlungen einer Person sind dann der einzige Zugang zu ihrem „Wesen“, indem sie „als Vollzug intentionaler Akte verstanden werden“ (Max Scheler). D.h. zu den Regeln und Normen einer Person kann ein Beobachter nur Hypothesen aufstellen und durch die Beobachtung ihrer weiteren Handlungen überprüfen. Das Wesen eines Mitmenschen erschließt sich situativ.
Dabei sollte man, wie bei den Überlegungen der Ökonomen, von einem „rationalen“ Menschenbild ausgehen; das ist nur eine neutrale Formulierung für ein egoistisches Individuum. In diesem Fall muss man auch mit Lügen und Täuschungen rechnen; besonders, wenn es um die globale Wirtschafts- und Finanzwelt geht, in der wahrscheinlich der größte Teil der Kriminalität zuhause ist.
Ähnlich verhält es sich mit denen, die im Umgang mit Menschen und Entscheidungen geschult sind. Sie, die die soft skills (emotionale Intelligenz) beherrschen, wenden sie an, ohne damit Emotionen zu verbinden. Es sind eingeschliffene Umgangsformen, die sich als erfolgreich erwiesen haben, die aber ohne Bedeutung sind.
Nach diesen Überlegungen und Relativierungen gibt es immer nur ein Provisorium: Wahrheitsähnlichkeit, Wahrscheinlichkeit - legitimiert durch das Kriterium der Bewährung.
3. Skizze zur Konkretisierung: Inhalte und Methoden der Bildungsfelder
Bildungsfeld 1: Naturwissenschaften - Zusammenhänge in komplexen Systemen
An politischen Entscheidungen kann sich die Mehrheit der Bürger nicht beteiligen, weil es an naturwissenschaftlichem Wissen und vor allem am Verstehen der Zusammenhänge mangelt. Dabei geht es nicht um Physik, Chemie und Biologie, sondern darum zu verstehen, was Physiker, Chemiker und Biologen machen, wie sie denken und arbeiten. Erst dann kann man die Ergebnisse auch beurteilen und Entscheidungen treffen.
Ziel dieses Bildungsfeldes muss es sein, eine Orientierung in den Naturwissenschaften zu bieten, um auch komplexe Zusammenhänge und schwierige Gedankengänge zu verstehen. Dieser Anspruch verlangt neben Kenntnissen das Wissen um Strukturen und Strategien.
Obwohl die empirischen Untersuchungen (Beobachtungen, Experimente) von der Wissenschaftsgemeinde geprüft und anerkannt und somit als objektiv angesehen werden, ist immer nur ein momentaner Wissensstand der Forschung erreicht - nicht die „endgültige Wahrheit“.
Inhalte und Methoden
Das große Paradoxon der Naturwissenschaften ist, dass mit dem lawinenartigen Anwachsen der Daten- / Informationsfülle die Stofffülle, die man beherrschen muss, abnimmt. Erkenntnisse, die unverbunden nebeneinander standen, werden erklärend verbunden, Muster werden erkennbar, einfache Prinzipien tauchen aus dem Chaos auf. D.h. der Inhalt z.B. des Biologieunterrichts sind nicht viele Fakten über eine Fülle von Lebewesen, sondern allen Lebewesen gemeinsame Systemeigenschaften und erste Einsichten in eine übersichtliche Zahl von Prinzipien, die den Systemfunktionen zugrunde liegen.
Das Kunsthandwerk der Unterrichtsplanung liegt nun darin, Pläne zu entwerfen, wie an motivierenden Fragestellungen (Themen) Prinzipien erarbeitet werden können und wie sich diese kumulativ zu einem Gesamtsystem vernetzen. Ziel ist ein strukturiertes Grundwissen, mit dem gearbeitet und auf das (lebenslang) aufgebaut werden kann.
Werden die Inhalte einfach erzählt, so liefert man "Antworten" noch ehe es Fragen gibt. Stellen sich die Fragen im späteren Leben tatsächlich einmal, hat man die Antworten längst vergessen. "Erarbeitet" ist das Gegenteil von erzählt oder vorgelesen (Naturkunde). Monologe und Fragen, die der Vortragende selbst beantwortet, sind die falsche Art der Vermittlung. Informationen sind Daten, die einzeln für sich nichts aussagen. Bedeutend und zu Wissen werden sie erst in jedem Individuum durch die Verknüpfung zu einem Netzwerk. Immer noch wird versucht, dieses Wissen durch alberne Bildchen und PowerPoint-Folien zu übertragen. Das ist sinnlos, da man zwar für Ruhe und Disziplin sorgen, aber niemanden zum Zuhören zwingen kann. Das Wissen muss jede/jeder für sich erarbeiten und zwar durch Selbstentdecken und Verstehen im Laufe eines problemlösenden und handlungsorientierten Unterrichts. Wir verstehen, wenn wir die Frage verstehen, auf die das Verstandene die Antwort ist und das Verstandene mit unseren (Vor-)Kenntnissen verknüpft wird. Verstehen führt zu Wissen.
Das Kausalitätsprinzip kann nicht wahrgenommen werden, sondern nur isolierte Ereignisse, nie deren kausale Verknüpfung. Es ist eine Kategorie des Verstehens - eine Prädisposition. Newton und Galilei konnten ihre Theorien nicht einfach aus zufällig gemachten Beobachtungen ableiten. Beobachtungen und Experimente müssen durch Entwürfe und Hypothesen vorstrukturiert sein, damit sie zu allgemeinen Gesetzen führen können.
Auch diese allgemeinen wissenschaftlichen Prinzipien (Naturgesetze) können nicht unmittelbar, sondern nur durch die logischen Folgen anhand der Erfahrung überprüft werden. Eine Fülle von Beobachtungen und Experimenten führt zu den Prinzipien. Daraus folgt in der Umkehrung, dass man in einer standortgebundenen Situation entscheiden muss, ob und welche Naturgesetze zutreffen - auch hier ist eine Art "Urtheilskraft" (das Besondere im Allgemeinen) nötig.
Erschwert wird die Entscheidung für den nächsten Schritt dadurch, dass in komplexen Situationen, die mehrere Personen betreffen, die objektiven Fakten alleine nicht für eine sichere Planung ausreichen.
Es ist viel Üben notwendig, um das Verhalten von komplexen Systemen zu analysieren und klare Fragestellungen herauszuarbeiten und anschließend die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungswege zu überdenken. Dabei erfährt man, dass es für komplexe Probleme keine einfachen Antworten mehr gibt.
Der naturwissenschaftliche Anteil des Weltbildes ist klar und objektiv, die Naturgesetze sind vielfach überprüft. Wenn Prinzipien aber auf die Realität des Alltags treffen, wird es schwierig und unübersichtlich, weil jetzt viele Menschen beteiligt sind - viele Subjekte.
Vermittlung und Einsicht in naturwissenschaftliche Erkenntnisse erfordern den Dialog zwischen zwei Personengruppen: den Wissenschaftlern und den Bürgern. Die Naturwissenschaftler und unabhängigen Akademien müssen endlich gesellschaftlich aktiv werden. Die Bürger müssen neugierig und aufnahmebereit sein (auch in der "postfaktischen Ära") und ihre klassische Bildung durch naturwissenschaftliches Methoden- und Basiswissen erweitern. Bei einem Dialog müssen sich beide Seiten Mühe geben, wenn er nicht in einem Austausch von Schlagworten stecken bleiben soll.
Einschub
Didaktik ↔ Ziele ↔ Methodik
Man kann Inhalte auf zwei ganz unterschiedliche Arten vermitteln:
zum algorithmischen Gebrauch = zum MACHEN
oder
zum ursächlichen Verständnis = SINN machen
Algorithmischer Gebrauch
Man (und auch der Computer) ist in der Lage, immer wenn die und die Situation vorliegt, dann die Eingangsdaten nach einem Programm zu bearbeiten und die Ausgabedaten zu liefern. Das Ziel ist erreicht.
Die Aufgabe der Ausbilder besteht dann in der Weitergabe von "Kochrezepten". Dabei ist eine hohe Präzision im Bereich der Arbeitsanweisungen notwendig (Fachsprache, Formeln, wiederkehrende Standardanweisungen), da Eigenkorrekturen nicht möglich sind. Den Geltungsbereich und die Aussagekraft muss man nicht kennen, wenn sie vor der Zuweisung der Arbeit von dem Vorgesetzen bedacht wurden.
Читать дальше