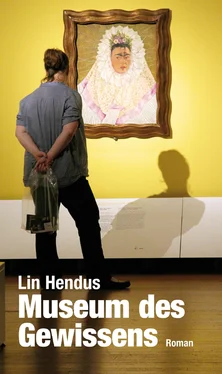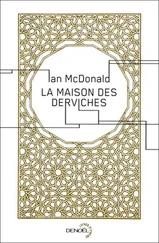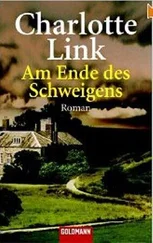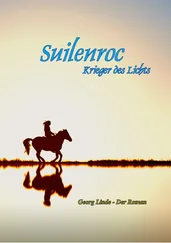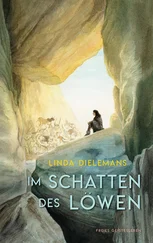Zu meinem großen Kummer verlor ich ganz früh meine Eltern, genauso wie du. Mein Vater kam an der Front ums Leben und meine Mutter starb vor Hunger. Mir gelang es jedoch, während dieser schrecklichen Kriegszeit dank der Familie deines Urgroßvaters am Leben zu bleiben. Er arbeitete als Leiter eines Lebensmittellagers, deshalb hatten wir immer etwas mehr zu essen als andere Familien. Satt waren wir nie, hatten aber jeden Tag unsere Mahlzeiten. Und ich hatte Glück: Nikolaj kam mit geringen Verletzungen aus dem Krieg zurück, und als er wieder gesund wurde, heirateten wir. Bald wurde unser Sohn Petenka, dein Vater, geboren. Er wurde groß, beendete die Schule, begann sein Studium und begegnete dem wunderbaren Mädchen, Iruschka Ivanova, das er später heiratete. Dann kamst du zu Welt, mein Antoscha.“
Großmutter wurde still und dachte nach. Mit traurigem Blick schaute sie die Lampe hinter meinem Rücken an. In ihren Augen zeigte sich eine Träne, dann eine weitere. Beide liefen langsam die Wangen herunter. Plötzlich, als würde Großmutter wieder zu sich kommen, holte sie tief Luft, nahm meine Hand, küsste sie und drückte sie an ihre weiche, warme und feuchte Wange.
„Der Knabe Antoscha schaffte es nicht, bis dahin groß zu werden, als Petja und Ira wegen eines betrunkenen Fahrers gleichzeitig sterben mussten. Und er blieb mit dir ganz allein“, fügte ich hinzu. Alinas Traurigkeit breitete sich in mir aus. Mein kleines Kinderherz krampfte sich zusammen. Ich wollte weinen, schämte mich aber, meine Schwäche zu zeigen. Deshalb presste ich einfach stark meine Zähne zusammen, sodass ich mir schmerzhaft auf die Zunge biss.
„Ja, mein Lieber. Genauso war es ... Es ist schwer, das Geschehene zu begreifen. Aber letztendlich ist das Leben ziemlich schlicht. Und gerade deshalb ist alles in ihm erstaunlich kompliziert. Denke daran und erschwere niemals grundlos dein Leben und das Leben anderer Menschen ...“
Nach diesem Gespräch vergingen etwa zwei Monate. Eines trüben herbstlichen Tages kam ich von der Schule nach Hause und sah vor unserer Wohnungstür Menschen in Polizeiuniform. Als einer von ihnen bemerkte, dass ich an ihnen vorbeiwollte, hielt er mich am Ärmel fest und sagte:
„Bist du Anton Glebow?“ Ja, ist doch klar. „Also, Junge, keine Eile. Bleib dort, wo du bist. Deine Großmutter gibt es hier nicht mehr.“
„Wo ist sie denn?“, fragte ich herausfordernd. „Sie wartet auf mich, weil sie weiß, dass ich aus der Schule komme. Und was machen Sie in unserer Wohnung? Lassen Sie mich durch!“
„Deine Großmutter wurde er…“, der Polizeibeamte stockte mitten im Wort, während er mich in die Richtung der Küche schob, „... eigentlich ist sie heute Morgen verstorben. Wir wurden von den Nachbarn gerufen. Geh mal zur Seite und warte solange dort.“
Die neuen Nachbarn, deren Namen ich nicht kannte und an deren Gesichter ich mich noch nicht einmal erinnern konnte, schauten mich mit großen Augen an und begleiteten mich mit fragenden, mitleidigen Blicken.
Es kam mir vor, als landete ich gegen meinen Willen in einer fremden, merkwürdigen Welt. Als schliefe ich fest und alles, was um mich herum geschah, wäre nur ein Alptraum. In meinem Kopf drehte sich alles leicht, der Boden unter den Füßen schien nicht echt zu sein, die Luft blieb mir weg. Gleich, in dieser Minute, würde ich aufwachen und alles wäre wieder so wie früher. Ich würde in mein Zimmer gehen und meine Großmutter sehen, die mir entgegeneilte.
Trotz meiner Bemühungen gelang es mir aber nicht aufzuwachen. Unbekannte Menschen mit und ohne Uniform liefen um mich herum.
Redeten miteinander.
Gaben unverständliche Worte von sich.
Schüttelten die Köpfe und schauten heimlich in meine Richtung.
Senkten die Blicke und wandten sich mühsam von einem großen dunkelroten Fleck ab, der sich unregelmäßig auf dem alten Teppich im Flur ausbreitete.
Nachdem ich ungefähr zwei Stunden später meine Sachen in Papas großen Rucksack gepackt hatte, versiegelten die Polizisten unsere zwei Zimmer, setzten mich in ihr Auto und fuhren zur Kindersammelstelle. Ohne zu erklären, was in meiner Abwesenheit wirklich zu Hause passiert war. In leicht mitfühlendem Ton wurde mir gesagt: „Bis zur Aufklärung der Sachlage.“ Welche Sachlage und wer sie erklären und aufklären musste, wurde mir nicht mitgeteilt.
Mich, einen Teenager, ließen sie in Unkenntnis meines eigenen Schicksals. Ich befand mich in absoluter Ungewissheit und fühlte mich wie an einem Gummiband aufgehängt, das mich mal herunterließ, mal wieder hochzog und durch das Schwanken Übelkeit hervorrief. Erst jetzt wurde mir klar, was ein Angstkokon, von dem mir meine Alina vor kurzem erzählt hatte, bedeutete. Keine Ahnung, wie, aber ich befand mich von Kopf bis Fuß fest eingewickelt in diesen rauen und klebrigen Kokon.
Meine Großmutter sah ich nie wieder.
Weder lebend noch tot.
Ebenso wie unsere Wohnung – meine einzige und sichere Zuflucht. Schlechte Menschen warfen mich aus dem Elternhaus in die ungewisse Welt hinaus und schlossen die Türe fest hinter mir, hinter der mein früheres Leben zurückblieb. Zwangen mich mit jeder Zelle meines Körpers, die unsichtbare und enge Grenze zwischen dem Guten und Bösen zu spüren, zwischen Barmherzigkeit und Gleichgültigkeit, Liebe und Hass. Zwangen mich unfreiwillig auf das unendliche und leere Feld unter meinen Füßen zu schauen.
Bei Antoscha Glebow fanden sich weder nahe noch entfernte Verwandte, deshalb wurde ich nach dem geltenden Gesetz und den bestehenden Verhältnissen drei unendlich lange Tage später aus der Kindersammelstelle in ein Kinderheim gebracht.
Vor einem Monat war ich vierzehn geworden.
Und mit meinen vierzehn Jahren blieb ich ganz allein.
Ohne Großmutter, Freude einer Familie und Zuhause.
Ohne den letzten dünnen Faden, der den Menschen an den Wohnort und die alltäglichen gewöhnlichen Sorgen bindet. An den Gedanken, dass dich jemand braucht. An das normale Leben eines jeden von uns.
Ich hatte noch nie gehört, geschweige denn gewusst, was ein Kinderheim war. Und wie sich herausstellte, war ich nicht der Einzige, der keine Verwandten und Freunde hatte. Von meinesgleichen gab es mehr als genug. Solche, die niemand haben wollte. Nicht Eltern, nicht Verwandte, nicht fremde Familien, nur die Beamten, die für uns bezahlt wurden. Die in ihren dicken Berichtsbüchern einen weiteren fetten Haken machten.
Einnahmen – Ausgaben.
Netto – brutto.
Eine nächste Einnahme, die vor ihren Köpfen landete, um die staatlichen Gelder, die ohnehin ständig fehlten, zu verschwenden.
Nein, meine Eltern hätten mich nie weggegeben.
Sie hätten es niemals tun können.
Niemals so, wie andere ihre leiblichen Kinder im Stich lassen. Sie hätten nicht zugelassen, dass ich in eine Atmosphäre von Abneigung und Bosheit geriet. Mama und Papa liebten mich sehr. Mich, ihren einzigen Sohn Antoschka. An ihrem Tod, der sie gleichzeitig ereilte, trugen sie keine Schuld. Wie schade, dass ich damals nicht bei ihnen war. Dann hätten mich die grenzenlose Einsamkeit, die Angst der Ungewissheit und das Gefühl des unersetzlichen Verlustes nicht verrückt gemacht. Diese Art von Erfahrungen durchzumachen, gehört nicht zur Kindheit. Es ist das Leben eines Erwachsenen, dem ich noch nicht gewachsen war.
Das Kinderheim machte auf mich einen schrecklichen Eindruck. Sowohl von außen wie von innen.
Unordentlich verputzte Wände mit schäbigem Anstrich.
Rissiger, splitteriger und dreckiger Boden aus knarrenden Dielenbrettern.
Geruch ewiger Armut, der aus jeder Ecke in die Nase stieg.
Dunkle Farben, dunkle Gerüche, dunkle Gefühle.
Essen, das Ekel erregt.
Blaues Kartoffelpüree.
Dünne Suppe mit einem schlecht geschälten Kartoffelstück und einem einsam schwimmenden Kohlblatt.
Читать дальше