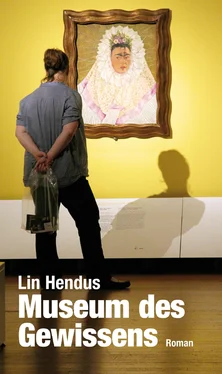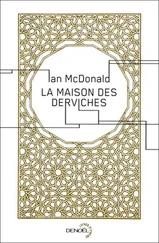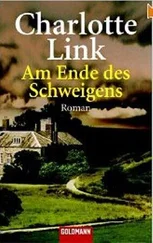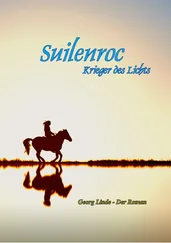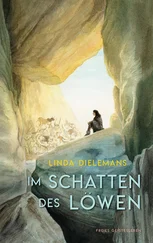1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 In der Besuchertoilette wusch ich meine Hände und das Gesicht. Die kleine Wunde am Finger zog sich zu und hörte auf zu bluten. Ich säuberte ein wenig meine Sachen und brachte meine Haare in Ordnung. Jetzt schaute mich kein Waisenkind, sondern ein ganz normaler Petersburger Junge aus dem Spiegel an. Ich drehte mich zum Fenster, holte aus der Tasche ein weiches Butterbrot mit Käse, das Julia Mutik extra für mich gemacht hatte, und begann langsam zu kauen. Denken wollte ich an nichts. Müdigkeit und die Aufregung des langen Tages zerrten an meinen Kräften, leerten meinen Kopf und verwirbelten meine Gedanken. Ich wollte nach Hause, in mein Bett. In das gemütliche Heim.
Die trockene Mahlzeit spülte ich mit Leitungswasser hinunter und machte mich auf die Suche nach einem ruhigen Schlafplatz. Für lange Tage und Nächte, Wochen und Monate. Weil ich sonst keine andere Bleibe hatte. Das große Museum war für mich, ein Waisenkind, der beste Zufluchtsort. Unvergleichlich besser als das Kinderheim. Viel besser als ein obdachloses Leben auf der Straße ...
Die Eremitage befand sich kurz vor der Schließzeit. Die Angestellten teilten dies dem deutlich dünner gewordenen Besucherstrom mit und freuten sich nach langem und schwerem Arbeitstag auf den Feierabend. Ich musste jetzt schnell ein unauffälliges Plätzchen finden und mich dort verstecken. Verbergen, verkriechen, vor den wachsamen Augen der Museumsangestellten verschwinden. Sie würden ganz bestimmt kein Mitleid mit mir haben. Dem Obdachlosen von der Straße, zu dem ich vor zwei Wochen geworden war. Dem ehemaligen normalen Jugendlichen.
Dieses riesige Museum mit hunderten von Sälen, kilometerlangen Parkett- und Marmorböden, Millionen von unschätzbaren Ausstellungstücken wählte ich zu meinem Wohnort.
Als Alternative für das verlorene Haus.
Als Ersatz für Großmutters Liebe.
Als großen und liebevollen Kokon der Sicherheit und Stabilität, in den ich mich so schnell wie möglich einhüllen wollte.
Kapitel 4 Unsichtbarer unter den Großen
Erst nach mehreren aufregenden Wochen fand ich endlich die richtigen Plätze zum Wohnen. Meine Schlafplätze. Zu meinem Glück fehlten in der Eremitage in den unruhigen achtziger Jahren gute Überwachungs- und Alarmsysteme. Wie übrigens auch schlechte. Angst, von Kameras entdeckt zu werden, hatte ich keine. Ehrlich gesagt dachte ich damals überhaupt nicht über Kameras nach. Ich wusste einfach nichts davon. Auf diese Idee kam ich erst viele Jahre später.
Das Museum wurde gut gelüftet und beheizt. Vielleicht auch nicht – jedenfalls blieb die Temperatur in den Museumsräumen mehr oder weniger konstant, entweder aufgrund der Vielzahl der Säle oder wegen der dicken Wände und hohen Decken. Ich weiß es nicht. Trotz der hinter den Fenstern fallenden Schneeflocken war es innen warm, wenngleich man in den kalten herbstlichen und später in den Winternächten manchmal nach mehr Wärme verlangte.
Was aber zum einzigen großen Überlebensproblem wurde, war die Nahrung. Besonders in den ersten Wochen. Der Hunger wurde zum bösartigen Begleiter des Flüchtigen. Der leere Magen stieß mich ständig in die Seite und trieb mich an: „Geh, geh weg von hier! Auf die Straße, in die Stadt! Dort gibt es genug zu essen. Wenn auch nicht sehr viel, aber dir reicht es auf jeden Fall. Im Gegensatz zu hier. Hier wirst du sterben. Geh und gib deinen Wunsch nach Freiheit auf. Besser unfrei, dafür aber satt. Was spricht gegen das Prinzip, am Leben zu bleiben, indem man auf die Freiheit verzichtet?“
Diese Art innere, sich häufig wiederholende Monologe gefielen mir nicht. Und ich blieb meinem Ziel, halbhungrig, aber frei zu sein, treu. Auch das hatte mir meine Großmutter beigebracht. Mit ihrer zärtlichen und weichen Hand hatte sie oft meinen Kopf gestreichelt und dabei wiederholt:
„Antoscha, wenn du etwas möchtest, dann wirst du es auch erreichen. Weißt du, mein Liebling, viele sind der Meinung, dass ihre Träume nur deswegen unerfüllbar sind, weil sie ihnen zu fantastisch, gar zu verrückt vorkommen. Freunde dich niemals mit solchen Leuten an – sie werden nichts im Leben erreichen. Ich lebe schon lange auf der Welt, habe vieles gesehen und erfahren, und gerade deshalb sage ich dir diese Worte: Hat der Mensch einen Traum, geht er bestimmt in Erfüllung. Dabei gibt es aber einen wichtigen Punkt, den diejenigen kennen, deren Träume erfüllt wurden. Diese Menschen brauchten viel Geduld, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Aber sie erreichten es, dem Pessimismus der Verwandten, dem Verrat der Freunde, dem Unglauben der Kollegen zum Trotz. Der Mensch, der nach vorne strebt, darf keinen Hauch von Zweifel hegen. Nur dann kann er alles erreichen. Nur dann siegt er. Nur dann gelangt er an sein Ziel.
Und es gibt noch etwas, das viele Menschen einfach vergessen – man muss ganz genau wissen, was man haben möchte. Kennst du noch die Worte aus einem Märchen: ‚Geht dorthin – weiß nicht, wohin. Hol das – weiß nicht, was‘? So geht es vielen von uns im Leben – wir wissen nicht, wohin wir möchten, was wir werden möchten, wovon wir träumen sollen. Das aber ist der allererste und wichtigste Schritt zur Erfüllung deiner Träume. Und wenn du nicht weißt, was du anstrebst, dann gelangst du niemals in die Welt deiner Fantasien. Also, Antoscha, hab keine Angst zu träumen. Glaub an dich, dann werden deine Träume bestimmt wahr!“
Diese Worte klangen oft in meinen Ohren und halfen mir, den Hunger zu unterdrücken. Ich träumte von einer Tafel voller Speisen. Davon, dass ich in einem hellen Zimmer vor dem Kamin saß und nach einem guten Abendessen meinen Bauch streichelte. Davon, dass ich ein Bergsteiger mit einem großen Rucksack auf den Schultern war und dass ich unbedingt den nächsten Gebirgspass erreichen musste. Den Ort, an dem sich die Hütte mit viel Essen befand. In meinen Träumen landete ich in Kaiserpalästen, in denen ich als Gast an reich gedeckten Tischen saß. In meinen Fantasien flog ich als Kosmonaut in den Weltraum, wo ich ungeduldig auf die Landung wartete, weil die Tür des Raumschiffs, hinter der sich die Essensvorräte in Tuben befanden, kaputt gegangen war.
Lange stand ich vor Gemälden, auf denen sich irgendetwas Essbares befand: Eine Schale mit Äpfeln, Wild, eine hängende Weintraube. Nachdem ich mir die Bilder angeschaut hatte, ging ich weg und pfiff dabei geringschätzig vor mich hin, so, als ob es mir ganz gleich sei. Und ich gewann.
Ich verließ das Museum nicht und starb auch nicht vor Hunger.
Leitungswasser gab es in den Toilettenräumen genug. Deshalb musste ich nicht auf das Trinken verzichten. Bis ich aber eine zuverlässige Nahrungsquelle fand, verging einige Zeit. Eines Tages entdeckte ich bei einem Spaziergang durch die Palastsäle eine Tür, die nach Feierabend nicht immer abgeschlossen wurde. Dahinter befanden sich die Räume der Museumsangestellten, kleine Personalzimmer.
Essen gab es dort nicht viel. Menschen, die in einer Umgebung von Gold, Marmor und Edelsteinen arbeiten, ernähren sich nur sehr sparsam. Ich musste mir viel Mühe geben, um die letzten Krümel, die sie vergessen oder für morgen versteckt hatten, zu finden.
Keksreste.
Eine Dose Sprotten in Tomatensoße.
Trockene Butterbrote.
Einen Apfel.
Ein Glas mit selbst eingelegten Gurken.
Eine Flasche Kefir.
Eine Packung Saft.
Ein Weißbrot.
In den kleinen Kühlschränken fand ich ab und zu Schmand, Wurstreste, Salate, gekochte Eier – Reichtum für den Hungrigen. Wichtig war dabei die Zurückhaltung. Nicht die gesamte Entdeckung auf einmal zu verspeisen, damit keinesfalls Verdacht geschöpft wurde. Kein einziger Mensch sollte erfahren, dass sich im Palast außer den Museumsexponaten noch jemand befand. Ihn nicht besuchen kam, sondern dort wohnte.
Es ist bekannt, dass zum Wohnen Häuser benutzt werden.
Читать дальше