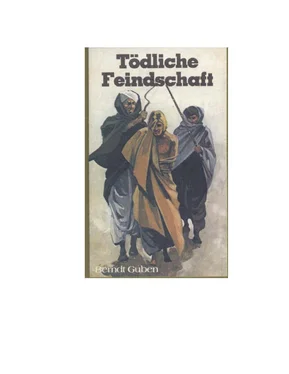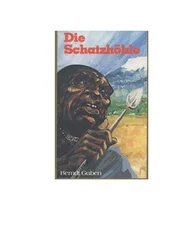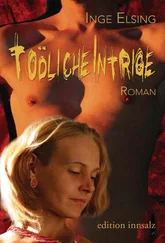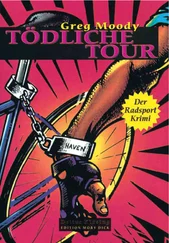Die Abenteurer waren froh über diesen Vorschlag. Es war ihnen nur zu willkommen, dieses unheimliche Land um den »Berg der bösen Geister« so schnell wie möglich zu verlassen.
Niemand hatte auch nur einen Gedanken oder ein Wort für jene Kameraden übrig, die durch den Überfall vielleicht nur verwundet waren. Keinem einzigen kam es in den Sinn, sich Sorgen darum zu machen, was mit ihnen geschehen würde, wenn die Eingeborenen sie gefangen hatten.
»Nun denn«, sagte Imi Bej, »reiten wir mit Hilfe Allahs. Der Prophet wird seine gläubigen Söhne nicht verderben lassen.«
Er setzte sich an die Spitze des Zuges und gab das Zeichen, aufzubrechen.Sie setzten sich in schnellen Trab.
Ringsum schien alles friedlich. Aber sehr schnell schon sollten sie eine bittere Überraschung erleben. Als sie jene Stelle erreichten, wo die Berge links und rechts ein wenig zurückwichen, wo das steppenartige Gebiet vor ihnen mit Gebüsch bestanden war, brach neues Unheil über sie herein.
Aus dem Gebüsch heraus erhielten sie plötzlich Feuer. Fünf von ihnen stürzten tot von den Pferden. Die ledigen Tiere stutzten, drehten sich um und jagten nach dorthin zurück, woher sie gekommen waren. Diesmal gab es für Imi Bej kein Zögern. Er und die beiden Jäger, die noch verblieben waren, setzten ihren Tieren den Dorn in die Seite, so daß diese von dannen flogen wie Pfeile. Aber es nutzte ihnen nichts mehr.
Hinter ihnen knallte es dreimal kurz. Alle drei fuhren sich mit schmerzverzerrten Gesichtern nach der Schulter. Niemand von ihnen konnte den rechten Arm mehr bewegen. Die Pferde aber, aufgescheucht durch das neuerliche Knallen, gehorchten den Reitern nicht mehr, sondern gingen durch. Das hatte zur Folge, daß die Verwundeten, die dieser Jagd nicht mehr gewachsen waren, schon nach einer kurzen Strecke aus dem Sattel stürzten. Dabei brach sich einer von ihnen das Genick.
Der zweite verlor die Besinnung. Nur Imi Bej blieb bei Bewußtsein.
Mühsam auf den linken Arm gestützt, richtete er sich auf. Er hätte sich diese Anstrengung sparen können. Ein Schwärm von schreienden Negern kam herangelaufen. Drohend schwangen sie ihre Flinten.
Es waren Balubas Leute, angeführt von dem Häuptling selbst und von Unogi, dem jungen Krieger. Wut und Haß standen in ihren Gesichtern. Mit blutunterlaufenen Augen stürzten sie sich auf die drei von den Pferden Geschossenen.
Ihre kurzen Speere blitzten.
Hinter ihnen tauchten zwei Reiter auf. Es waren Ojo und Michel. Der Pfeifer hatte sich, um die Gegend besser übersehen zu können, mit Ojo einen etwas entfernteren, höher gelegenen Platz ausgesucht. Von hier aus hatte er mit drei wohlgezielten Schüssen die letzten Überlebenden der Katastrophe aus den Sätteln geholt. Auch diesmal hatte er sich nicht überwinden können, sie zu töten. Deshalb die Schulterschüsse.
Balubas Leute hatten Blut gerochen. Und obwohl vorher vereinbart worden war, daß etwaige Überlebende an Michel abgeliefert würden, richteten sie sich nicht danach. Als Michel und Ojo herankamen, schrie der Pfeifer schon von weitem: »Nicht töten! Nicht töten!« Aber da war es schon zu spät.
Imi Bejs letzter Blick war mehr erstaunt als erschrocken. Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde zog sein ganzes Leben noch einmal an ihm vorüber. Aus war der Traum von der Macht.
Hier lag er im Staub, wehrlos, preisgegeben denen, die er bisher gejagt hatte. Klar erkannte er, daß es keine Rettung mehr gab. Einen ganz kleinen Augenblick, bevor ihn die Speerspitze Unogis durchbohrte, schloß er die Augen.
Der Satan von Sansibar würde niemals Gouverneur des Imam von Maskat werden.
Imi Bej hatte sein böses Leben ausgehaucht. — »Schweinerei«, brummte Ojo. »Mögen Schweinehunde gewesen sein; aber wehrlos waren sie doch.«Michel nickte. Das Massaker im Tal und das Gemetzel hier an dieser Stelle hatten ihn sichtlich mitgenommen. Seine Lippen waren blutleer. Seine Augen flatterten unstet.
Dann aber nahm er sich zusammen:
»Was können wir tun, Diaz? — Sie haben ihr Unglück selbst verschuldet. Die Naturgesetze lauten eben: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und unsere schwarzen Freunde sind ein Stück Natur. Es wäre unmöglich gewesen, sie vom Töten abzuhalten.«
Ojos Lippen verzogen sich.
»Nun, Señor Doktor, um ehrlich zu sein, ich habe nicht nur aus Menschenfreundlichkeit so gesprochen. Ich mußte an unsere Schätze denken, die dieser Imi Bej oder wie er heißt, unserem Freund Paulus Krämer geklaut hat. Vielleicht hätten wir von ihm erfahren können, wo sie zu finden sind.«
»Möglich«, sagte Michel, »aber das sei unsere geringste Sorge; denn schließlich lagern noch eine ganze Menge der Steine und Perlen im Schloß Aradmans. Wir werden also trotz Paulus Krämers Dummheit nicht als arme Leute heimwärts segeln.«
»Bueno, bueno«, sagte Ojo und hatte ein zufriedenes Gesicht.
Die beiden Weißen machten sich daran, die flüchtigen Pferde der Araber einzufangen. Mit den gezähmten Zebras, wie die Wadschagga sie nannten, konnten diese eine Zucht anfangen.
Auf dem Rückweg zum Ort der Schlacht war Michel sehr schweigsam. Er überdachte alles noch einmal. Vierzig Tote also waren das Ergebnis dieses Tages. Das war die negative Seite.
Aber gab es nicht auch eine positive?
Ja, das Geheimnis des Dschaggalandes, die Stille des Berges waren gewahrt. Michel würde dafür sorgen, daß Ugawambi nicht wieder etwas darüber verlauten ließ.
Als sie auf dem Kampfplatz ankamen, sahen sie, wie die Krieger Aradmans zwischen den Toten herumwimmelten. Jeder wollte irgendein Beutestück mit nach Hause bringen. Am begehrtesten waren selbstverständlich die Gewehre.
Aber darauf hatte bereits der König seine Hand gelegt. Seine Leibwache war damit beschäftigt, die Donnerbüchsen einzusammeln.
Der König hatte vor der Schlacht das Gebot erlassen, sämtliche erbeuteten Waffen, ganz gleich welcher Art, ins Schloß zu bringen, damit er sie besichtigen konnte.
Auch hier waren ein paar Pferde am Leben geblieben. Man hatte die sich sträubenden Tiere eingefangen und ihre Herren, soweit sie nur verwundet waren, getötet.
Ein Historiker würde jetzt wahrscheinlich Vergleiche ziehen zwischen dieser und der Schlacht im Teutoburger Wald.
Michel mußte bei dem Gedanken daran lächeln, wenn er sich vergegenwärtigte, mit welcher Mühseligkeit er als Junge in der Lateinstunde die Einzelheiten dieser Schlacht ergründen mußte.
Und hier war alles so einfach gewesen. Ein paar Steine, ein wenig Pulver —, und vierzig gutausgerüstete Jäger waren nicht mehr.
Mit dem Leuchten der Freude in den Augen begrüßte Aradman den Pfeifer.
»Sei mein Freund auf immerdar!« rief er dankerfüllt. »Du hast uns gerettet ! Dir allein verdanken wir, daß unser Volk noch am Leben ist ! Wir werden den Göttern opfern.damit sie dich fernerhin schützen. — Willst du nicht bei uns bleiben?«
Michel lächelte. Er begegnete dem Ausbruch des anderen mit Freundlichkeit.
»Du wirst verstehen«, sagte er diplomatisch, »daß auch in meiner Heimat Aufgaben auf mich warten. Ich kann nicht hier bleiben. Und ich glaube auch nicht, daß das nötig ist; denn durch das, was wir an Waffen, Gerät und Pferden von den Sklavenjägern erbeutet haben, seid ihr allen anderen Gegnern im weiten Umkreis überlegen.«
»Da hast du recht«, freute sich Aradman.
Michels Miene wurde wieder ernst.
»Was soll mit den Toten werden?« fragte er.
»Nichts, wir lassen sie liegen. Zum Fraß für die Geier.«
»Wollen wir sie nicht begraben?«
»Begraben? — In die Erde vergraben, meinst du?«
Michel nickte bestätigend und erklärte dem König, daß das in seinem Heimatland so Sitte sei.
»Das heißt«, vergewisserte sich Aradman, »daß auch ehrenvolle Menschen nach ihrem Tod in die Erde gegraben werden?«
Читать дальше