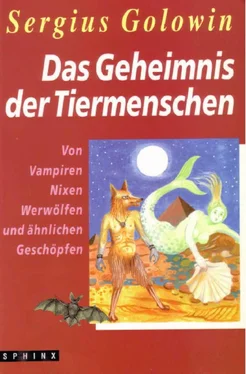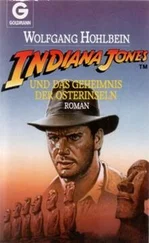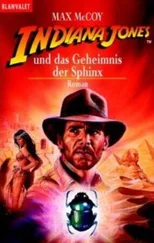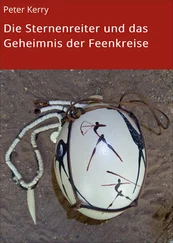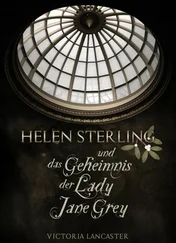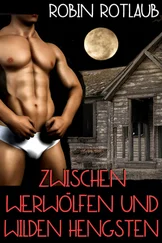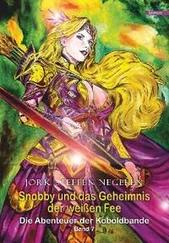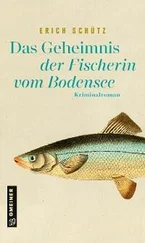Aus diesem Grund wurde nach der Sage im Aaretal und in ähnlichen Landschaften die Adlerfeder ein Zeichen für Unabhängigkeit und Freiheit. Man trug eine solche an seinem Hut, aber nicht nur, wenn man ein kühner Jäger war. Viele taten es auch, um zu zeigen, daß sie «niemandes Sklaven waren» und zumindest in ihrem Lebenskreis nach eigenem Willen und Brauch lebten.
Da die französische Sprache vom Juragebirge und dem Bielersee her ans Aaretal angrenzt, kannte ich schon früh ein altes Wort für einen kühnen, selbständigen Menschen. Man nannte ihn «debonaire». Der Französischlehrer erklärte mir den Ausdruck als aus den romanischen Worten «de bon aire» zusammengesetzt. Das heißt deutsch: Er ist «aus guter Luft».
Gemeint sei gewesen, der Mensch entstamme einem «Adlernest», also aus einem «luftigen» Stamm, der sich zu allen Zeiten seiner stolzen Freiheit erfreute. Man sehe ihm an, daß alle seine «adlergleichen» Vorfahren niemanden demütig als ihren Herrn und Meister anerkannten.
Unsere Märchen aus dem 18. Jahrhundert, aufgeschrieben und gestaltet von Musäus, stimmen mit dem tiefsinnigen Sprachgefühl des Volkes überein: Sie enthalten die gleichen Gedanken wie die Sagen um die Rassen der Tiermenschen auf der ganzen weiten Welt.
Was unsere Namen verraten
Nicht nur Wappen und Herkunftslegenden der Ritterfamilien und Stämme verweisen auf enge Beziehungen zu bestimmten Tieren und deren Umwelt. Auch die alten Vornamen von Kindern erinnern häufig an Eigenschaften der wilden und zahmen Geschöpfe, wie man sie einem Menschen anwünschte.
Die Sagen verweisen uns dauernd in ein Zeitalter, da man die Bezeichnung des neuen Erdenbürgers keinem Zufall überließ. Die schwangere Frau begegnete etwa im Wald einem gutmütigen Bären: Das Kind, das sie darauf glücklich gebar, hieß etwa Bernhard, was starker Bär bedeutete.
Manchmal heißt es auch in den Volksmärchen: Eine Fee oder ein Wilder Mann sei aus dem Walde gekommen und habe den jungen Eltern geraten, ihrem künftigen Kind einen bestimmten Namen zu verleihen. «Dies wird ihm in seinem Dasein nur Glück bringen», versichern dabei die weisen Gäste. Wer denkt hier nicht an die Stämme der Indianer oder der Sibirier des Polarmeeres, bei denen ihre Medizinmänner oder Schamaninnen bei jeder Geburt guten Rat wußten?
Die Menschen unserer unmittelbaren Vergangenheit waren Meister in der Beobachtung der Tiere, die sie aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft kannten. Ausdrücklich lesen wir etwa in der «Legende des Heiligen Wolfgang», die schon 1475 im kleinen Städtchen Burgdorf am Bergfluß Emme gedruckt wurde: Es gibt kaum Menschennamen, die von den Tieren herkommen, die nur erschreckend wirken können.
Der bibel- und legendenkundige Verfasser des Buches versichert uns, daß wir jeden der Tiernamen «auf zweierlei Weise» anwenden können. Als Beispiel wird uns ausführlich gezeigt, daß etwa der Löwe in der christlich-jüdischen Tradition bald den grimmigen, uns bedrohenden Teufel bedeuten kann - und dann wieder den Erlöser der Welt, den Heiland, die Gottheit selber. «Siehe es siegte der Löwe vom Stamme Juda», heißt es ausdrücklich von Christus.
Die Schafe können nach den frommen Schriften den Herdenmenschen kennzeichnen, der ohne Geist und selbständige Gedanken mit der ganzen Masse der Hölle zutrottet. Das gleiche Tier verweist aber häufig auf den Frommen, der voll kindlichen Vertrauens den Geboten des Himmels folgt: Anschließend wird ausdrücklich auf den bald gefürchteten und dann wieder bewunderten Wolf hingewiesen, von dem schließlich der Taufname des Heiligen Wolfgang herkommt.
Jedes Tier hat demnach Seiten seines Wesens, die geradezu beneidenswert sind. Es hat aber auch Eigenschaften, vor denen sich der Mensch lieber hüten sollte. In diesem Sinn versichert uns auch das Buch von 1475: «Folglich geht daraus hervor, daß keiner (der von Geburt her einen Tiernamen trägt, S. G.) gerechtfertigt oder verworfen wird durch den Namen.»
Ebenfalls noch im 15. Jahrhundert entstand auf der Grundlage antiker und einheimischer Fabeln der Abenteuerroman «Reineke der Fuchs». Er erfreute sich in verschiedenen Fassungen großer Beliebtheit im Volk: Die Künstler haben ihn hoch bewundert, und kein geringerer als Wolfgang von Goethe hat ihn nachgedichtet.
Die Tierwelt, vor allem die Säugetiere und Vögel, bilden in ihm ein Weltreich und sprechen miteinander wie Menschen. Die gewaltige Fülle echter Naturbeobachtungen des Altertums und des Mittelalters ist hier sehr großzügig verwertet. Sehr unterhaltend ist über die Verwandtschaften der einzelnen Arten nachzulesen, wie man sie sich damals vorstellte und beobachtete.
Am wichtigsten in dem gleichermaßen hochgebildeten und volkstümlichen Werk ist ein Spiegel der menschlichen Staaten des ausgehenden Mittelalters. An der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide stehen Löwe und Löwin. Ihre Macht über die Untertanen ist unbestritten: Erstens sind sie nun einmal mächtige, schöne und stolze Tiere. Dazu sind sie auch großzügiger und gutmütiger, als man es einem Raubtier zutraut.
Um das hohe Paar bildet die übrige Tierwelt einen malerischen Kreis. Jedes Hofamt wird von dem Geschöpf eingenommen, dessen Eigenschaften man dafür als einigermaßen geeignet ansah. Der Hauptinhalt des Werks ist die Darstellung einer politischen Umwälzung, wie sie sich wohl gerade im 15. Jahrhundert auf der Bühne Europas abspielte.
Eine der hervorragendsten Stellungen im Staat besitzt der mutige, blutrünstig-kriegerische, doch dazu ziemlich gradlinigehrliche Wolf Isegrimm. Unbestritten ist er aber wegen seiner Gewaltherrschaft und Räuberei gefürchtet. Durch Lug und Trug geht er seiner Vormacht verlustig und wird ins Elend gestoßen: Sein Ehrenplatz am Hof wird schrittweise vom listigen Fuchs und dessen Verwandten erobert.
Der schlaue Reineke führt den arglosen Löwen namentlich durch sein angeblich nützliches Wissen an der Nase herum: Er verblendet den König mit Plänen, die das Denken der prachtsüchtigen Großkatze völlig verwirren. Stets berichtet er von Schätzen, die in der Erde liegen sollen, und zu denen nur er den Weg weiß. Der König sieht davon zwar kein einziges Goldstück, wird aber geradezu süchtig auf das ewige Gerede vom Fortschritt zu zukünftigen Reichtümern. Eigentlich sehen wir im Fabelbuch genau das, was in der damaligen Wirklichkeit stattfand! Unter dem französischen Ludwig XL und im Herzogtum Burgund wurde die kriegerische Ritterschaft von einer Oberschicht verdrängt, die geschickt mit meist zweifelhaften Wirtschaftsplänen zu spielen wußte.
Der Mensch der Vergangenheit sah die Tierwelt als das Kunstwerk des Gleichgewichts zwischen verschiedenen Geschöpfen. Jedes von ihnen besaß in der Natur einen Aufgabenkreis, in dem es eigentlich kein anderes Wesen zu ersetzen vermochte. Die menschliche Gesellschaft sollte stets entsprechend eingerichtet sein, jeder sollte in ihr «seinen» Platz einnehmen. Dieser diente dann gleichzeitig den innersten Neigungen des Einzelnen - und auch der Allgemeinheit! Das Tierreich, wie es die naturnahen Menschen kannten, galt als Vorbild oder Urbild des mittelalterlichen Staates.
Die Bedeutung eines Amts, also König, General, Priester, Bauer, Jäger usw. wurde oft mit der Bedeutung eines daran erinnernden Tiers in der Umwelt verglichen: Es sollten für jeden Beruf Leute gewählt werden, die entsprechende Eigenschaften besaßen. Der Mensch fand es also richtig, von der Natur zu lernen.
Die Erkenntnis der Heiligen Hildegard
Die Heilige Hildegard von Bingen versichert uns als Grundlage ihrer Naturkunde: «Die Tiere, die auf Erden leben, versinnbildlichen die Gedanken und Überlegungen des Menschen, die er in die Tat umsetzt.»
In diesem Sinne versuchte sie es möglichst genau zu beweisen: «Die anderen Waldtiere (die Heilige redete unmittelbar vom Löwen und Panther!) bezeichnen die Fülle der Möglichkeiten, die der Mensch hat, nützliche und unnütze Werke zu vollbringen. Die zahmen Tiere auf der Erde bezeichnen die Sanftmut des Menschen, die er hat, wenn er auf dem rechten Wege ist.»
Читать дальше