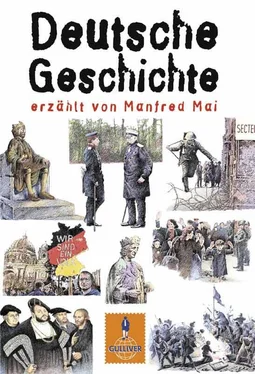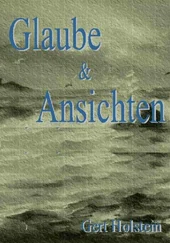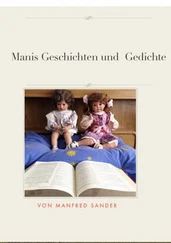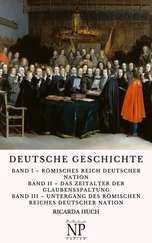Manfred Mai - Deutsche Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Mai - Deutsche Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Deutsche Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Deutsche Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Deutsche Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Deutsche Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Deutsche Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die prächtigen Häuser der Patrizier standen meistens in der Nähe des Marktplatzes. Etwas abseits davon wurden die Gassen enger, die Häuser einfacher und schmuckloser. Da der Platz in den Städten bald knapp wurde, baute man die Häuser höher. Im Erdgeschoss befanden sich die Arbeitsräume, im ersten Stock Wohn- und Schlafzimmer. Unter dem Dach hatten Lehrlinge und Gesinde ihre Schlafstätten, die oft nur aus einem Strohlager bestanden. Die Nahrung der einfachen Menschen in der Stadt unterschied sich kaum von der der Bauern. Die meisten waren froh, wenn sie jeden Tag satt wurden. Nur die wohlhabenden Bürger konnten sich regelmäßig Mahlzeiten mit Fleisch, Fisch, Gemüse, Salaten und dazu Wein leisten.
Eine Gruppe von Menschen lebte in den Städten isoliert: die Juden. Ihre eigene Religion, ihre Sitten und Gebräuche trennten sie von den Christen. Als Nichtchristen waren sie im Grunde rechtlos. Aber seit der Karolingerzeit standen sie unter dem besonderen Schutz des Königs – den sie allerdings bezahlen mussten. Das war für sie meistens kein Problem, denn es gab viele reiche Juden. Deren Reichtum aber weckte den Neid der Nichtjuden. Und dass sie im Gegensatz zu den Christen für ausgeliehenes Geld Zinsen nehmen durften, auch Wucherzinsen, steigerte die Abneigung vieler Christen noch.
Die Kirche trat für eine strenge Isolierung der Juden von der christlichen Bevölkerung ein. Juden durften keine Christen heiraten, keine Grundstücke kaufen, kein Handwerk ausüben, nicht in der Verwaltung arbeiten und mussten in eigenen Vierteln, den »Gettos«, wohnen. Hier stand die Synagoge, hier predigte der Rabbiner und hier lag auch der Judenfriedhof.
Aus dem Jahr 1215 stammt eine Verordnung, nach der sich Juden durch eine besondere Kleidung als Juden kenntlich machen mussten. Man zwang sie, einen spitzen Hut zu tragen und einen gelben Fleck auf ihre Kleider zu nähen. Und schon im Mittelalter kam es immer wieder zu Ausschreitungen gegen Juden, zu Verfolgungen und Mord.
So frei, wie seit Jahrhunderten behauptet und erzählt wird, machte die Stadtluft also keineswegs. Und weil in den Städten viele Leute auf engem Raum zusammenlebten, waren die hygienischen Verhältnisse oft schlechter als in den Dörfern. In den Straßen und Gassen lag allerlei Unrat, das Trinkwasser war schmutzig, die Lebensmittel oft verdorben, was zu Krankheiten und Seuchen führte. Manchmal starben ein Viertel und mehr der Einwohner einer Stadt an solchen Seuchen, vor allem an der Cholera und am »schwarzen Tod«, der Pest.
Nach zwei Kapiteln über das Alltagsleben im Mittelalter handelt das folgende wieder von der großen Politik. Die mittelalterlichen Menschen waren von dieser Politik zwar betroffen, aber anders als die Menschen heute gestalteten sie sie nicht mit. Oft nahmen sie das politische Geschehen überhaupt erst dann wahr, wenn sie, wie in Kriegszeiten, Opfer wurden.
Wer ist der Höchste im Land?
Seit Otto I. gab es wieder einen »Römischen Kaiser«, der sich als Schutzherr und weltlicher Führer der Christenheit sah. Gleichzeitig beanspruchte der Papst in Rom die Rolle des geistlichen Führers. Während die Ottonen, wie das Geschlecht nach ihrem bedeutendsten Vertreter Otto I. genannt wurde, auf dem Thron saßen, gab es keine ernsthaften Probleme zwischen Papst und Kaiser. Auch als im Jahre 1024 das Geschlecht der Salier die Ottonen ablöste, änderte sich daran nichts. Die Autorität der Ottonen und der ersten Salier-Kaiser war so groß, dass sie Äbte und Bischöfe ihres Vertrauens einsetzen konnten. Heinrich III. ging sogar noch weiter: Er setzte drei Päpste ab und ersetzte sie durch deutsche Bischöfe. In den siebzehn Jahren seiner Regentschaft saßen fünf Deutsche auf dem Heiligen Stuhl in Rom. Alle fünf sind jedoch früh gestorben, und schon Zeitgenossen munkelten, es sei mit Gift nachgeholfen worden.
Vielen Geistlichen ging der Einfluss der weltlichen Herrscher auf die Kirche schon lange zu weit. Als Heinrich III. mit erst 39 Jahren starb und ihm sein minderjähriger Sohn Heinrich IV. nachfolgte, sahen diese Geistlichen eine große Chance zum Handeln. Sie setzten durch, dass der Papst ohne Einmischung des Kaisers von sieben Kardinälen gewählt wurde.
Im Jahr 1075 verlangte der neue Papst Gregor VII. noch mehr: Nur der Papst dürfe Bischöfe einsetzen und absetzen. Ja, er könne sogar den Kaiser absetzen und die Untertanen von ihrem Treueeid entbinden. Das hatte zuvor noch kein Papst auszusprechen gewagt.
Der junge deutsche König wollte auf das Recht zur Einsetzung (Investitur) von Bischöfen keinesfalls verzichten und erklärte den Papst für abgesetzt. Daraufhin »bannte« der Papst den König, das heißt, er schloss ihn aus der Kirche aus. Der Bannspruch des Papstes wurde in vielen Kirchen vorgelesen: »Zur Ehre und zum Schutz der Kirche entziehe ich im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, kraft der Macht und Gewalt des Apostels Paulus, dem König Heinrich, Kaiser Heinrichs Sohn, die Herrschaft über das Reich der Deutschen und über Italien und löse alle Christen von dem Treueeid, welchen sie ihm geleistet haben oder noch leisten werden, und ich untersage jedem, ihm künftig als einem König zu dienen.« – Die Menschen konnten es kaum fassen. Ihr König im Bann wie der schlimmste Verbrecher. So etwas hatte es noch nie gegeben.
Der Bann zeigte Wirkung. Viele Lehnsmänner des Königs schlugen sich in diesem Streit auf die Seite des Papstes. Zum einen, weil sie selbst vom Bann bedroht waren; zum andern, weil sie darin eine Möglichkeit sahen, die eigene Macht zu stärken. Sie stellten Heinrich ein Ultimatum: Falls er nicht innerhalb eines Jahres vom Bann gelöst sei, wollten sie einen neuen König wählen. Wenn Heinrich also König bleiben wollte, musste er sich mit dem Papst versöhnen. Mitten im Winter machte er sich auf den Weg nach Italien. Zur gleichen Zeit war der Papst auf dem Weg nach Deutschland, um mit den deutschen Fürsten über das Schicksal des Königs zu entscheiden. Als er hörte, dass Heinrich nicht mehr weit sei, fürchtete er einen bewaffneten Angriff und floh in die Burg Canossa. Heinrich folgte ihm ohne Soldaten. Es heißt, der Papst habe ihn drei Tage lang in einem Büßergewand im Vorhof der Burg warten lassen, bevor er ihn empfing. Heinrich habe um Gnade gebettelt und schließlich habe der Papst den Bann aufgehoben.
Noch heute spricht man vom »Gang nach Canossa«, wenn jemand bei einem Gegner um Gnade bitten und sich dabei in gewisser Weise demütigen muss.
Mit dem Canossagang war der »Investiturstreit« allerdings nicht beendet. Es ging auch nicht mehr nur um Heinrich und Gregor. In dieser langen Auseinandersetzung ging es letztlich um die Frage, ob die weltliche oder die geistliche Macht an erster Stelle stehen sollte. Für alle gültig beantwortet wurde diese Frage bis zum Ende des Mittelalters nicht.
Von edlen Rittern
Wer heute durch Deutschland reist, kann an vielen Orten Burgen und Burgruinen sehen. Sie sind ein Überbleibsel aus der Ritterzeit.
Ritter waren zunächst einmal nichts anderes als Lehnsmänner, die mit ihrem Herrn in die Schlacht ritten. Aus diesen schwer gerüsteten Reitern entstand allmählich ein eigener Stand mit einer eigenen Lebensweise und strengen Regeln. Das begann schon mit der Ausbildung. Dabei sollten »Pagen« und »Knappen« nicht nur Reiten und Kämpfen, sondern auch gutes und höfliches Benehmen lernen. Vor allem aber sollten sie begreifen, dass der wahre Ritter nicht für den eigenen Vorteil kämpft, nicht aus Ruhmsucht oder gar zum Vergnügen, sondern stets zum Schutz des Glaubens und der Gerechtigkeit. Er hilft den Schwachen und Bedürftigen, ist edelmütig, großzügig, ehrenhaft und ohne Furcht und Tadel. Diesem Idealbild haben mit Sicherheit nicht alle Ritter entsprochen – man denke nur an die Raubritter.
In Friedenszeiten galten die Jagd und die Teilnahme an Turnieren als standesgemäßer Zeitvertreib für einen Ritter. Zur ritterlichen Lebensweise gehörte auch die so genannte »Minne«, die Verehrung adliger Frauen, um deren Gunst und Liebe bei Turnieren gekämpft wurde. Manche rühmten die Frauen auch in Erzählungen und Gedichten, die sie zur Laute vortrugen. Als die bekanntesten »Minnesänger« gelten heute Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Hartmann von Aue und Heinrich von Ofterdingen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Deutsche Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Deutsche Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Deutsche Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.