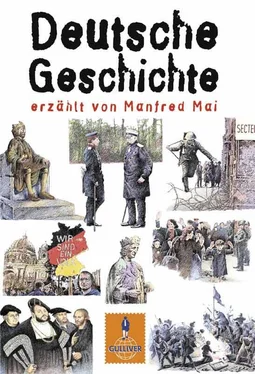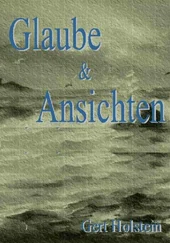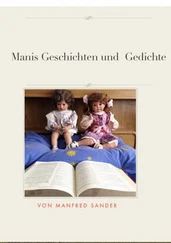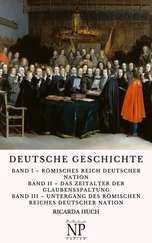Manfred Mai - Deutsche Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Mai - Deutsche Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Deutsche Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Deutsche Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Deutsche Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Deutsche Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Deutsche Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Um der Kriegspflicht zu entgehen, unterstellten sich freie Bauern den Adligen, Bischöfen und Klöstern. Diese übernahmen dann für ihre Bauern die Kriegspflicht, schützten sie auch vor Überfällen und halfen ihnen in Notzeiten. Das taten die neuen Herren natürlich nicht umsonst. Die Bauern mussten ihnen dafür ihren Besitz übergeben. Zwar durften sie das Land weiter bewirtschaften, mussten aber einen Teil der Ernte und regelmäßig Fleisch, Käse, Milch und Eier abliefern. Außerdem mussten die Bauern »Frondienste« leisten, das heißt ohne Lohn auf den Wiesen und Feldern ihres Herrn mitarbeiten. Sie mussten Wege anlegen, Brücken bauen und beim Bau von Burgen und Schlössern mithelfen. Sie konnten auch nicht einfach wegziehen, denn sie gehörten zu dem Land, das sie bebauten. Deswegen nannte man sie »Hörige«. Der Grundherr durfte ihnen zwar alles befehlen, aber vom Hof vertreiben oder verkaufen durfte er die Hörigen nicht, denn sie waren nicht sein Eigentum.
Anders sah die Sache bei den »Leibeigenen« aus. Nach germanischer und römischer Überlieferung galten sie nicht als Personen, sondern als Sachen. Sie waren völlig rechtlos und wurden nicht besser behandelt als das Vieh. »Wenn ich das nicht erfülle oder mich Eurem Dienst irgendwie entziehen will, sollt Ihr das Recht haben, mich nach Gutdünken zu bestrafen, zu verkaufen oder sonst mit mir zu tun, was Ihr wollt«, heißt es in einer Schwurformel zwischen Leibherr und Leibeigenem.
Um das Jahr 1000 gab es nur noch wenige freie Bauern und den meisten von ihnen ging es nicht besser als den Hörigen. Ob frei, hörig oder leibeigen, das »gemeine Volk« wurde von den höheren Ständen verachtet. Davon zeugen Sprüche wie: »Der Bauer und sein Stier sind zwei grobe Tier« oder: »Der Bauer ist an Ochsen statt, nur dass er keine Hörner hat.« Dabei trugen die Bauern alle anderen Stände sozusagen auf ihren Schultern.
Die Bauern lebten zusammen in kleinen Dörfern, die 20 bis 30 Höfe umfassten. Jeder war auf die Mithilfe des anderen angewiesen, deshalb wurden die wichtigsten Arbeiten miteinander geplant und ausgeführt. Vor allem das Roden der Wälder konnte nur gemeinsam geschafft werden. Daran hatten die Bauern und der Grundherr ein großes Interesse. Denn mehr Land für Ackerbau und Viehzucht bedeutete zwar noch mehr Arbeit, aber auch mehr Einkommen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche war in drei Hauptflächen aufgeteilt, an denen jeder Bauer seinen Anteil hatte. Auf einem Teil wurde Sommergetreide, auf einem Wintergetreide angebaut. Der dritte Teil blieb ein Jahr unbebautes Brachland, damit sich der Boden wieder erholen konnte. Diese Dreifelderwirtschaft hatte seit der Zeit Karls des Großen nach und nach die alte Zweifelderwirtschaft abgelöst.
Um das Ackerland zog sich die »Allmende«. Das waren Wälder und Wiesen, die der Allgemeinheit gehörten und von allen Dorfgenossen genutzt wurden. Auf den Weiden weidete das Vieh, die Wälder lieferten Bau- und Brennholz. Zur Allmende gehörten auch Bäche, Flüsse und Seen.
Die Arbeitszeit wurde durch die Jahreszeit bestimmt. Im Sommer standen die Bauern zwischen vier und fünf Uhr auf. Die erste Mahlzeit nahmen sie erst zwischen neun und zehn ein, die zweite am späten Nachmittag. Gegessen wurden vor allem Suppen, Hafer-, Mehl- und Hirsebrei, dazu gab es Brot aus Roggenmehl, Gemüse, Eier, Käse und Milchspeisen. Seltener kamen Fisch oder Huhn auf den Tisch und im Winter schlachtete man ein Schwein. Manchmal fing man mit Schlingen oder Fallen einen Hasen oder ein Reh, bis das im 14. Jahrhundert von den Grundherren verboten wurde. Zu trinken gab es Wasser und Milch. Sobald es dunkel wurde, ging man schlafen, denn Öl für Lampen war teuer.
Wohnraum und Stall waren zwar getrennt, lagen aber unter einem Dach. In den meisten Bauernhäusern bestand der Wohnbereich nur aus einem einzigen Raum. Darin standen ein Tisch, ein paar Bänke an den Wänden, dreibeinige Hocker und manchmal ein Bettgestell. Meistens wurde auf Strohsäcken geschlafen. Wenn am Morgen das Tageslicht durch die mit Weidengeflecht oder Schweinsblasen nur notdürftig verschlossenen Fensterlöcher fiel, begann für die Familie wieder ein harter Arbeitstag. Auch die Kinder mussten schon kräftig mithelfen. Sie trugen die gleichen Kleider wie die Erwachsenen, arbeiteten wie die Erwachsenen und führten das gleiche Leben. Es gab auch keine Schulen, wie wir sie heute kennen. Bildung war Adligen oder wohlhabenden Bürgern vorbehalten, die in Universitäten, Klöstern oder von Privatlehrern unterrichtet wurden. Deshalb konnten die Bauern weder lesen noch schreiben.
Sehr früh wurden Ehen geschlossen. Mädchen wurden oft schon mit 13 Jahren verheiratet. Eine Vorschrift des Klosters Weitenau im Schwarzwald besagte zum Beispiel, dass der Probst »jeder Frau des Klosters, die 14 Jahre alt ist, bei Strafe von einem Pfund gebieten soll, einen Mann zu nehmen«. Für die Männer wurde das Heiratsalter auf 18 bis 20 Jahre festgesetzt. Dies wurde so strikt geregelt, weil die Grundherren die Zahl ihrer Untertanen vergrößern oder wenigstens halten wollten. Ehepaare bekamen durchschnittlich sechs bis acht Kinder, von denen jedes vierte schon im ersten Lebensjahr starb. Viele Kinder wurden nicht einmal zehn Jahre alt.
Auch viele Frauen starben sehr früh, weil die zahlreichen Schwangerschaften und die schwere Arbeit sie schwächten und für Krankheiten anfällig machten.
Die große Mehrheit der Menschen führte also ein beschwerliches Leben in Armut und Unwissenheit. Daran änderte sich bis ins 15. Jahrhundert so gut wie gar nichts und bis ins 18. Jahrhundert nicht viel, egal welcher König oder Kaiser gerade regierte.
Macht Stadtluft frei?
Vor tausend Jahren gab es in Deutschland etwa 200 Städte. Das waren natürlich keine Städte, wie wir sie kennen. Die meisten hatten nicht einmal tausend Einwohner. Neben den alten Römerstädten wie Trier, Worms, Köln und Mainz entstanden neue. Weil der Handel mit Gütern aus nah und fern zunahm, brauchten die Händler sichere Plätze, wo sie ihre Waren lagern und anbieten konnten. Deswegen wuchsen viele neue Siedlungen an Kreuzungen wichtiger Handelswege, an Flussübergängen und Häfen. Auch in der Nähe von Burgen und Klöstern wuchsen Siedlungen, die zu Städten wurden.
Das Zentrum einer Stadt war ihr Marktplatz, auf dem Kaufleute, Handwerker und Bauern ihre Waren anboten. Wer seine Waren auf dem Markt verkaufen wollte, musste an den Stadtherrn (König, Herzog, Bischof, Graf) zuvor etwas bezahlen. Marktgebühren und Zölle wurden zu neuen Einnahmequellen für die Stadtherren. Deshalb waren sie sehr daran interessiert, ihre Städte für Kaufleute und Handwerker attraktiv zu machen. Zum Schutz des Marktes und der Bürger wurde um die Stadt herum eine Mauer gebaut.
Um den Handel besser organisieren zu können, schlossen sich die Kaufleute zu so genannten »Gilden« zusammen. Und was für die Kaufleute die Gilden, waren für die Handwerker die »Zünfte«. Die Zunftordnung regelte für jedes Handwerk die Rechte und Pflichten der Meister, Gesellen und Lehrlinge. Auch was in welcher Anzahl und Qualität hergestellt werden durfte, bestimmten nicht die einzelnen Meister, sondern die Zünfte. Ebenso die Preise und Löhne. Die Zünfte wachten streng über die Einhaltung ihrer Regeln. Und sie gewannen bald auch großen Einfluss auf die Stadtpolitik. Reiche Handwerksmeister und wohlhabende Kaufleute wurden zu einer Art neuen Adelsschicht, die man »Patrizier« nannte. Für sie galt der Satz »Stadtluft macht frei« tatsächlich. Formal galt er für alle Bürger einer Stadt. Anders als die meisten Bauern waren sie persönlich frei, das heißt, sie konnten Wohnung und Beruf frei wählen, konnten heiraten, wen sie wollten, über ihren Besitz frei verfügen, ihn vermehren oder verkaufen – wenn sie welchen hatten! Denn die meisten Menschen in der Stadt hatten kaum mehr, als sie zum Leben brauchten. Die städtische Freiheit hat die Unterschiede zwischen Reich und Arm nicht beseitigt. Neben den wohlhabenden Kaufmannsfamilien und reichen Handwerksmeistern gab es viele arme Handwerksgesellen, Knechte und Mägde. Sie wohnten oft im Haus ihrer Herren und Meister und hatten zu tun, was man ihnen befahl. Sie waren tatsächlich kaum freier als hörige Bauern.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Deutsche Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Deutsche Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Deutsche Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.