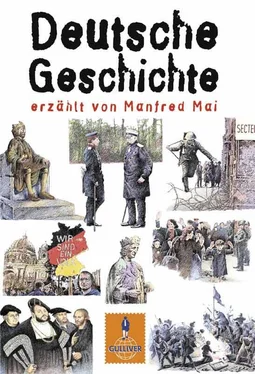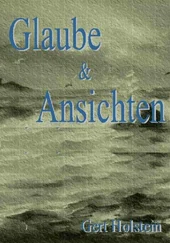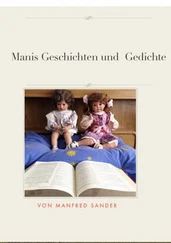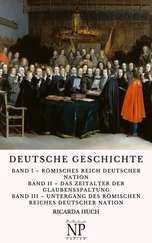Manfred Mai - Deutsche Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Mai - Deutsche Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Deutsche Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Deutsche Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Deutsche Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Deutsche Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Deutsche Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Damit hatte Karl sein Ziel erreicht: Zum ersten Mal in der Geschichte waren alle germanischen Stämme, die später zum deutschen Volk zusammenwuchsen, in einem Reich vereint. Das allein hätte für manche schon ausgereicht, ihn »der Große« zu nennen. Doch zu einem großen König gehört mehr, als Kriege zu gewinnen.
Nach allem, was wir heute wissen, verstand sich Karl als eine Art Vater seiner großen Völkerfamilie und kümmerte sich mehr als andere Könige um die Sorgen und Nöte des einfachen Volkes, das ein armseliges Leben führte. Er regierte nicht von einer Hauptstadt aus, sondern reiste oft durch das Reich, um sich selbst ein Bild von den Zuständen zu machen. Dafür gab es überall so genannte »Pfalzen«, Paläste, in denen der König Hof hielt. In manchen Pfalzen blieb er nur wenige Tage, in anderen viele Monate. Karls Lieblingspfalz war Aachen, wo er 814 starb und begraben wurde.
Trotz der vielen Reisen kam Karl in manche Gebiete des riesigen Reiches höchstens alle paar Jahre. Deswegen ließ er sich von überall her berichten und bestimmte dann, was zu geschehen hatte. Dabei regelte er auch kleinste Angelegenheiten wie den Verkauf von Feldfrüchten, Federvieh und Eiern.
Er ließ Wald roden, um mehr Ackerland für die Bauern zu schaffen, und führte die »Dreifelderwirtschaft« ein, die schonender mit dem Ackerboden umging und zu besseren Ernten führte.
Auch die Bildung lag Karl am Herzen. Er ließ Kloster- und Domschulen einrichten, in denen Kinder von freien Bauern und Handwerkern in Religion, Lesen und Schreiben unterrichtet wurden. Er selbst beschäftigte sich mit allen Wissenschaften, mit Kunst und Literatur und war immer bemüht, Neues zu lernen.
Karl sah sich jedoch nicht nur als Vater der Menschen im Frankenreich, sondern auch als Schutzherr aller Christen. Als er am Weihnachtsabend des Jahres 800 in Rom einen Gottesdienst besuchte, setzte ihm der Papst, dem Karl schon mehrfach gegen Angreifer geholfen hatte, eine Krone auf. Dann fiel er auf die Knie und rief: »Karl dem Erhabenen, dem von Gott gekrönten großen und Frieden schaffenden Kaiser der Römer, Leben und Sieg!«
Karl soll sehr erschrocken sein und später gesagt haben, dass er die Kirche nie betreten hätte, wenn er von der Absicht des Papstes gewusst hätte. Aber so wurde er der erste deutsche Kaiser des Mittelalters und gleichzeitig der weltliche Führer der Christenheit.
Dass Karl wirklich ein großer König und Kaiser war, zeigte sich nach seinem Tod noch deutlicher als zu seinen Lebzeiten.
Deutschland nimmt Gestalt an
So merkwürdig es klingen mag: Für die Karolinger war es leichter gewesen, das Frankenreich zusammenzuerobern, als es zu regieren und zu verwalten. Bei den damaligen Verkehrswegen dauerte es Wochen, ja Monate, bis Anordnungen des Kaisers überall im Reich bekannt waren. Ein großer Kaiser, wie Karl es war, konnte das Reich dank seiner Autorität noch zusammenhalten. Aber diese Autorität besaß sein Sohn Ludwig der Fromme nicht. Schon zu Ludwigs Lebzeiten begannen seine drei Söhne um das Erbe zu streiten. Zwei von ihnen – Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche – verbündeten sich gegen Lothar, ihren älteren Bruder. Im Straßburger Eid von 842 schworen sie sich vor ihren Heeren die Treue. Dieser Eid musste den Soldaten Karls in Altfranzösisch, denen Ludwigs in Altgermanisch vorgelesen werden, damit sie ihn verstehen konnten. Das zeigt, dass Westfranken von Ostfranken auch durch eine Sprachgrenze getrennt war. Die Menschen in den verschiedenen Teilen des großen Frankenreiches verstanden einander nicht.
Nach dem Tod Ludwigs des Frommen erhielt Karl den westlichen, Ludwig den östlichen Teil des Reiches und Lothar das Land in der Mitte. Als Lothars Geschlecht ausstarb, fielen große Teile dieses Mittelstückes an West- und Ostfranken. Damit war der Kernbereich Europas geteilt, und die entstandene Grenze blieb für 800 Jahre fast unverändert.
Anfangs hielten trotz der Teilung alle noch an der Idee von der Einheit des karolingischen Reiches fest. Aber mit dem Aussterben der Karolinger im 10. Jahrhundert fielen die beiden Teile endgültig auseinander. Und mit der Wahl des Sachsen Otto I. durch die ostfränkischen Stammesfürsten zu ihrem König begann im Jahr 936 endgültig die deutsche Geschichte, auch wenn von Deutschland oder einem Deutschen Reich noch keine Rede war.
Die mittelalterliche Ordnung
Mit Otto I. saß 150 Jahre nach Karl dem Großen wieder ein starker Herrscher auf dem Thron. Ihm gelang es, die Macht der Stammesherzöge einzuschränken und die Macht des Königshauses wieder zu festigen. Wesentlich dazu beigetragen hat der Sieg über die Ungarn, die mehrfach mit Reiterheeren aus dem Osten zu Raubzügen ins Reich eingedrungen waren. Im Jahr 955 schaffte es Otto I. mit seinem Heer, die Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld bei Augsburg so entscheidend zu schlagen, dass sie sich nie mehr so weit vorwagten. Damals soll ihm der Beiname »der Große« gegeben worden sein.
Sieben Jahre später wurde er vom Papst in Rom zum Kaiser gekrönt und galt damit als Nachfolger Karls des Großen. Von nun an waren die deutschen Könige wieder Römische Kaiser und Schutzherren der Christenheit. Ihnen gehörte das Land von Italien bis zur Nordsee, vom Rhein bis zur Elbe. Immer noch war die Sicherung und Verwaltung eines so großen Reiches nicht einfach. Für beides war der Kaiser auf Hilfe angewiesen. Er suchte sich geeignete Gefolgsleute, die ihm mit Rat und Tat zur Seite standen und dafür belohnt wurden. »Vasallen« nannte man diese Gefolgsleute, und der Kaiser bezahlte sie nicht mit Geld, sondern mit Landgütern. Die bekamen sie allerdings nicht als Eigentum, sondern nur geliehen. Solche Landgüter nannte man »Lehen«, die Vasallen waren Lehnsmänner des Kaisers. Viele Lehen waren so groß, dass die Besitzer selbst wieder Lehnsmänner brauchten, so genannte Untervasallen. Und selbst die konnten wieder Vasallen haben.
Mit der Zeit bildete sich eine Lehnsordnung heraus, die genau festlegte, wer wessen Lehnsherr sein durfte. Als direkte Lehnsmänner des Kaisers kamen nur die höchsten weltlichen und geistlichen Adligen in Frage. Diese Reichsfürsten konnten Lehen an Grafen und Freiherrn vergeben und die wieder an Ritter und hohe Beamte.
Als Lehen konnten nicht nur Land samt allen darauf lebenden Bauern vergeben werden, sondern auch Herrschaftsrechte des Kaisers wie Gerichts-, Markt-, Zoll- und Münzrechte. Lehnsherr und Lehnsmann schworen sich gegenseitig einen Treueeid: »Deine Feinde sind meine Feinde, deine Freunde sind meine Freunde. Ich will dir allzeit treu zugetan und gegenwärtig sein, wenn du mich brauchst.«
Ursprünglich erhielten Vasallen ihr Lehen nur auf Lebenszeit, aber im Lauf der Zeit wurde es üblich, Lehen an die Erstgeborenen weiterzugeben – sie wurden erblich und damit der Verfügungsgewalt des Kaisers entzogen. Das trug langfristig zur Stärkung der Reichsfürsten bei.
Die mittelalterliche Ordnung in Staat und Gesellschaft beruhte auf dem Lehensprinzip. Weil das lateinische Wort für Lehen »feudum« heißt, sprechen wir von einer Feudalordnung. Welche Stellung jemand in der mittelalterlichen Gesellschaft einnahm, war bestimmt durch den Stand, in den er hineingeboren wurde. Das Standesdenken war stark ausgeprägt. Die verschiedenen Stände unterschieden sich nicht nur in ihrem Ansehen und ihrem Vermögen, sondern auch in ihrer Kleidung voneinander. Man kleidete sich »anständig«, also so, wie es nach festgelegten Regeln für die einzelnen Stände vorgeschrieben war. Den Bäuerinnen war es zum Beispiel verboten, eng anliegende, ausgeschnittene Kleider, Pelze oder teuren Schmuck zu tragen, auch wenn sie es sich leisten konnten. Diese Dinge waren adligen Damen und reichen Bürgerinnen vorbehalten.
Vom Leben des »gemeinen Volkes«
Zur Zeit Karls des Großen lebten auf dem Gebiet Deutschlands etwa 4 Millionen Menschen, die allermeisten davon als Bauern. Viele besaßen eigenes Land, waren frei und hatten das Recht, Waffen zu tragen. Damit waren sie auch verpflichtet, mit dem König in den Krieg zu ziehen. Weil der König viele Kriege führte, waren die Bauern oft nicht auf ihren Höfen, wenn es Zeit gewesen wäre, zu säen und zu ernten – und viele kamen nie mehr nach Hause.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Deutsche Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Deutsche Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Deutsche Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.