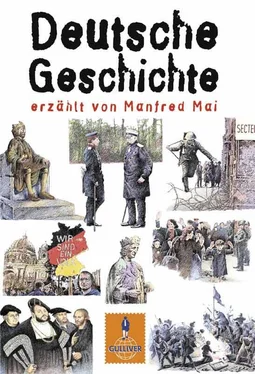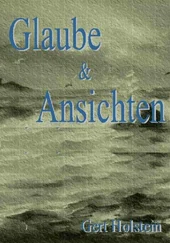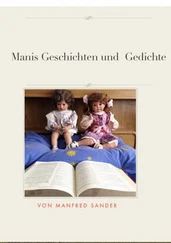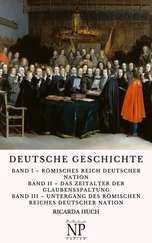Manfred Mai - Deutsche Geschichte
Здесь есть возможность читать онлайн «Manfred Mai - Deutsche Geschichte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Deutsche Geschichte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Deutsche Geschichte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Deutsche Geschichte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Deutsche Geschichte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Deutsche Geschichte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte forderte seine Landsleute in den Reden an die deutsche Nation auf, sich »Charakter anzuschaffen« und wieder Deutsche zu werden. »Lassen wir nur nicht mit unserm Körper zugleich auch unsern Geist niedergebeugt und unterworfen und in die Gefangenschaft gebracht werden!«
Der Historiker und Schriftsteller Ernst Moritz Arndt ging noch weiter und schrieb vom »Hass gegen die Franzosen«, der nötig sei, um die Freiheit wieder zu erkämpfen.
In diese nationale Aufbruchstimmung hinein platzte die Nachricht, dass Napoleons 600 000 Mann starke Armee in Russland vernichtend geschlagen worden sei. Der als unbesiegbar geltende Napoleon war besiegt worden, das machte den Deutschen Mut. Gleichzeitig war die Trauer groß, weil etwa 200 000 Soldaten der französischen Armee aus den deutschen Rheinbundstaaten stammten. Von diesen 200000 kehrten nur wenige tausend in ihre Heimat zurück. Das steigerte den Hass auf die Franzosen noch und führte zu einer nationalen Welle, von der bald auch der preußische König mitgerissen wurde. Am 17. März 1813 appellierte er an das Nationalgefühl der Preußen und anderen Deutschen und rief zum Krieg gegen Frankreich auf. Aber auch ohne diesen Aufruf waren viele Männer bereit, für die Freiheit und das Vaterland zu kämpfen. Zum ersten Mal musste das Volk nicht in einen Krieg gezwungen werden, denn nicht die Fürsten, sondern das Volk wollte diesen »Befreiungskrieg«. Die französische Armee wurde von der Koalition aus Preußen, Russland, England, Schweden und Österreich in der »Völkerschlacht« bei Leipzig (16. bis 19. Oktober 1813) geschlagen. Im Frühjahr 1814 zogen die Verbündeten in Paris ein. Die Rheinbundstaaten kündigten ihr Bündnis mit Napoleon, der abdanken musste und auf die Insel Elba verbannt wurde. Die französische Herrschaft über Deutschland und Europa war zu Ende.
Was ist des Deutschen Vaterland?
Nach der Befreiung von dem »französischen Unterdrücker« träumten viele Menschen von einem vereinten Deutschland, in dem das Volk mitbestimmen und mitregieren sollte. Aber genau davor hatten die europäischen Fürsten Angst. Auf dem »Wiener Kongress« vom Herbst 1814 bis zum Sommer 1815 wollten sie Europa neu ordnen – und dabei möglichst viel beim Alten lassen. Vor allem der österreichische Kanzler Fürst Metternich hätte die Uhr am liebsten zurückgedreht, um die Zustände vor 1789 wiederherzustellen. Dabei bereitete »die deutsche Frage« wieder einmal besondere Probleme. Während Ernst Moritz Arndt in einem Gedicht forderte, »das ganze Deutschland soll es sein«, wollten weder die deutschen noch die anderen europäischen Fürsten so ein »ganzes Deutschland«. Das schien allen zu groß und zu mächtig.
Stattdessen schufen sie einen »Deutschen Bund«, in dem die 35 souveränen deutschen Staaten und vier Freie Städte locker zusammengeschlossen waren. Deren Vertreter bildeten den »Bundestag«, der unter österreichischem Vorsitz in Frankfurt tagte. Doch in diesem Bundestag saßen nur die Gesandten der Regierungen, keine Volksvertreter. Die Macht lag wie bisher bei den Fürsten.
Die Menschen waren sehr enttäuscht. Dafür hatten sie in den Befreiungskriegen nicht gekämpft. Vor allem die bürgerliche Bildungsschicht stritt nun in Schriften und Reden für Verfassungen und einen Nationalstaat.
Während sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung bald wieder ins Privatleben zurückzog, schlossen sich an den Universitäten freiheitlich denkende – »liberale« – Studenten und Professoren in den so genannten »Burschenschaften« zusammen. Im Jahr 1817 feierten 500 von ihnen auf der Wartburg den 300. Jahrestag der Reformation. An diesem historischen Ort forderten sie unter schwarz-rotgoldenen Fahnen ein einiges, freies Deutschland, verbrannten Bücher mit rückwärts gewandtem – »reaktionärem« – Inhalt, eine preußische Uniform und einen österreichischen Korporalstock.
Solche Demonstrationen provozierten die Fürsten natürlich. Und als am 23. März 1819 der Theologiestudent Carl Sand den Schriftsteller August von Kotzebue erstach, weil der als Anhänger der Fürsten und russischer Spion galt, war das für die Obrigkeit Anlass zum Handeln. Wieder war es Metternich, der auf harte Maßnahmen drängte. In den »Karlsbader Beschlüssen« wurden die Burschenschaften verboten und aufrührerische »radikale« Studenten zu Festungshaft verurteilt. Etliche Professoren wurden entlassen, die Universitäten von der Polizei überwacht. Zeitungen, Flugblätter und politische Schriften durften »erst dann gedruckt werden, wenn sie vorher von den Regierungen genehmigt worden sind« – mit anderen Worten: Es herrschte »Zensur«.
In Österreich und Preußen wurden diese Beschlüsse besonders streng angewandt, um die alten Monarchien zu retten. Doch selbst Metternich ahnte, dass sich die freiheitlichen Kräfte nicht mehr dauerhaft unterdrücken ließen. Seinem Tagebuch vertraute er an: »Mein geheimster Gedanke ist, dass das alte Europa am Anfang seines Endes ist.«
Wieder keine Revolution
Nach so vielen Umwälzungen, Kämpfen und Kriegen sehnten die Menschen sich nach Ruhe. Die große Mehrheit des Volkes nahm auch die Einschränkungen durch die Karlsbader Beschlüsse widerstandslos hin. Man zog sich von der Politik zurück, und wer es sich leisten konnte, widmete sich dem privaten Glück, das vor allem in einem behaglichen Familienleben bestand. Dazu gehörten Hausmusik und Spiele ebenso wie gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge. Die revolutionären Gedanken überließ man wieder ganz den Dichtern, Denkern und Künstlern. Aber auch die besangen jetzt lieber die Natur und romantische Gefühle. Franz Schubert komponierte Am Brunnen vor dem Tore und das Heidenröslein , Eduard Mörike dichtete »Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte … « und Caspar David Friedrich malte seine Landschaftsbilder. Kurz: »Romantik« war angesagt.
Der Maler Carl Spitzweg hat das idyllisch-beschauliche Leben der Kleinstädter in vielen Bildern dargestellt. Später wurde diese Zeit etwas spöttisch das »Biedermeier« genannt. Der »deutsche Michel« als das Sinnbild des deutschen Bürgers tauchte hier zum ersten Mal auf: treuherzig, gemütlich, verschlafen und ziemlich naiv tappte er durch Zeitungen und Journale. Die biedermeierliche Idylle währte allerdings nicht lange. Ohnehin war für die meisten Menschen das Leben auch in diesen Friedenszeiten nicht idyllisch. Sie mussten für ihr tägliches Brot schwer arbeiten und hatten kaum Muße für romantische Gefühle.
Und es gab immer noch Menschen, die nicht nur an ihr privates Glück dachten, sondern von einem Vaterland für alle Deutschen träumten. Als es im Juli 1830 in Paris zu Straßenkämpfen kam, in deren Folge der französische König floh und die Regierung abgesetzt wurde, schwappte die Revolutionswelle schnell über ganz Europa. In Deutschland erhielt die Einheits- und Freiheitsbewegung neuen Auftrieb.
Aufstände in mehreren deutschen Ländern führten dazu, dass die Fürsten dem Volk Verfassungen und Landtage zugestehen mussten. Die neue Bewegung gipfelte im »Hambacher Fest«, zu dem am 27. Mai 1832 etwa 30000 Menschen kamen. Für damalige Verhältnisse war das eine gewaltige Zahl. Der liberale Publizist Siebenpfeiffer hielt eine flammende Rede: »Leuchtende Strahlen der Hoffnung zucken auf, die Strahlen der Morgenröte deutscher Freiheit, und bald, bald wird ein Deutschland sich erheben, herrlicher, als es jemals gewesen … Ja, es wird kommen der Tag, wo ein gemeinsames deutsches Vaterland sich erhebt, das alle Söhne als Bürger begrüßt und alle Bürger mit gleicher Liebe, mit gleichem Schutz umfasst … Wir selbst wollen, wir müssen vollenden das Werk, und ich ahne, bald, bald muss es geschehen, soll die deutsche, soll die europäische Freiheit nicht erdrosselt werden von den Mörderhänden der Aristokratie.«
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Deutsche Geschichte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Deutsche Geschichte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Deutsche Geschichte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.