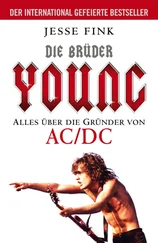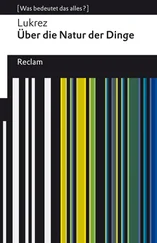Betty durchschwebte die grünstichige Welt, verabschiedete ihre Kollegin in den hellen Tag und setzte sich an den Schreibtisch im Vorraum, um die Patientenakten zu studieren. Sie hatte kaum geschlafen in dieser Nacht, in diesem Gästezimmer, in dem sie sich nichts anderes wünschte, als nach Hause zu gehen, wo sie bereits war. Trotzdem fühlte sie sich keineswegs müde, sondern gespannt, aufgezogen, als ticke die Uhr in ihr schneller, um die endlose Länge der Nacht auszugleichen. Alfredo hatte ihr kein Frühstück gemacht an diesem Morgen, sondern nur einen Espresso getrunken, hatte die Zeitungen durchgeblättert, in äußerster Eile trotz der frühen Stunde, im Stehen, vielleicht weil sein Stuhl neuerdings besetzt war von einem unsichtbaren Mitbewohner, jenem anderen, der vor ihm da gewesen war und vor dem sie nicht sicher war, nicht einmal in Italien, wo die Höhe der Alpen und die vielen Jahre zwischen ihnen lagen, und an dessen Augen und Haar und Hände sie gedacht hatte in der schlaflosen Nacht auf der Gästecouch. Wie viele Erinnerungen, verblasste Bilder, verklungene Sätze hineinpassen in so eine schlaflose Gästecouchnacht, dachte sie. Ihre Augen brannten, sie blinzelte. Ein graues Computergesicht schaute sie an. Und ihr anderes Leben hinter den Bergen, hinter den vielen Jahren. Immer wieder Tom Holler vor der glänzenden Fläche eines Sees. Und Holler am Klavier, Zigarette im Mundwinkel, Augen halb geschlossen vor dem Zigarettenrauch. Der Blumenhügel eines frischen Grabes, von Bienen umsummt. Ein Holzkreuz. Sie hatte den Namen und die Daten gelesen, immer wieder, um sich zu vergewissern: Marc Baldur, geb. am 08. 03. 1969, gest. am 21. 05. 1997. Sie hatte sich gewundert über die Betriebsamkeit der Bienen, die keinen Unterschied machten zwischen Friedhofsblumen und Nichtfriedhofsblumen, über die Helligkeit der Sonne an diesem Tag, die ihr zeigte, dass die Welt sich weiterdrehte, sich aber keineswegs um die Menschen drehte, und diese kopernikanische Wende hatte sie hinausgeschleudert in einen entlegenen Platz des Universums, Lichtjahre entfernt von Holler, der neben ihr am Grab ihres Freundes stand. Sie las die Daten auf dem Holzkreuz. Sie las die Patientenakten. Ein Neuzugang in der Nacht, marginale Überlebenschancen, Verkehrsunfall mit Vespa und LKW, epidurale Blutung, nach Notoperation Rezidivblutung. Die Angehörigen hatte man telefonisch vorbereitet, ein ausführliches Gespräch für den Vormittag anberaumt. Zwei weitere präfinal, sonst die übliche OP-Nachsorge. Betty stand auf, tauchte wieder in die grünstichige Stille des Patientenzimmers.»Er wird es nie erfahren«, hatte Tom gesagt. Über ihnen die Leere des Himmels, der alles gesehen hatte mit seinem großen blauen Auge. Der Himmel aber hatte geschwiegen, dachte sie.
Sie überblickte die Reihe der Betten zwischen den Raumteilern. Die Körper unter den Decken waren kaum zu unterscheiden am Relief der Füße, der Knie, der Schenkel, weil sie angesichts des allgemeinen, des für alle gleichen, des keinen Unterschied machenden Todes das Individuelle bereits verloren zu haben schienen. Stets näherte man sich ihnen vom Fußende her, die Perspektive gedehnt, die flache Wölbung des Körpers, die blassen Hände, die immer auf der Bettdecke lagen, zur Berührung bereit, und ganz hinten, unter Beatmungsmasken und Schläuchen verborgen und kaum zu erkennen, das Gesicht. Betty Morgenthal näherte sich den Betten, sank bis an den Grund.
Das Gesicht des Neuzugangs, Federica Bonardi, wohnhaft in Pozzuoli, fünfzigjährig, die laut Polizeibericht am Vortag, wie jeden Sonntagvormittag, in der Konditorei Sfogliatelle hatte einkaufen wollen und, wohl wegen des starken Regens, beim Abbiegen vom Fahrer eines Lieferwagens übersehen worden war, schien unversehrt und erstaunlich jung. Betty spritzte ein blutdrucksenkendes Mittel, obgleich es hier weniger um Heilung als um die Aufrechterhaltung der vegetativen Funktionen ging und ein schneller unspektakulärer Tod für alle Beteiligten die beste Lösung wäre, ein leises, kaum wahrnehmbares Hinübergleiten in die Dunkelheit, ähnlich dem wortlosen Schließen eines Vorhangs.
Signor Bonardi trug, als er kam, ein hellblaues Köfferchen in der Hand. Er stellte es im Vorzimmer neben sich ab, darin seien Kleider zum Wechseln für seine Frau, Unterwäsche, Pantoffeln, ein Schlafanzug, soweit er alles gefunden habe. In einer Plastiktüte hielt er ihre Medikamente, man habe am Vortag darum gebeten. Bonardis breite Schultern fielen in Richtung Fußboden, als er im unerbittlichen Neonlicht des Ärztezimmers stand. Alles an diesem großen schweren Mann schien hinabstürzen zu wollen, und es war nicht ersichtlich, wodurch er sich aufrecht hielt. Weil alles zugleich stürzt vielleicht, dachte Betty, verbot es sich aber. Rechts neben ihm die Tochter, etwa zwanzigjährig, links der Sohn, unwesentlich jünger. Sie rahmten den Vater, als ob sie ihn stützen wollten, aber der Abstand zwischen ihren Körpern war ein wenig zu groß, zu vereinzelt standen sie in der Neonhelle des Zimmers.
Betty Morgenthal nahm die Medikamententüte entgegen, die niemand mehr brauchen würde, und bat die Familie, sich zu setzen. Sie würde gern, sagte sie, mit ihnen sprechen, bevor sie zu der Kranken hineingingen. Sie wartete, bis die Angehörigen sich auf den Angehörigensesseln niedergelassen hatten, gepolsterte, bequeme Sessel waren es, in denen man einsank. Angehörige , dachte sie, indem sie sich kaum merklich mit ihrem Drehstuhl hin und her bewegte, was für ein seltsamer Ausdruck im Deutschen, den sie in Gedanken auch noch nach Jahren benutzte, weil es für ihn im Italienischen keine Entsprechung gab, der ausschließlich für negative, ja beinahe stets den Tod betreffende Gelegenheiten, wie schwere Krankheiten, Unfälle etc., benutzt zu werden schien, niemals für erfreuliche. Einem Menschen angehörig schien man erst dann zu sein, wenn man diesen verlor.
Betty räusperte sich und setzte ein bekümmertes, aber nicht zu bekümmertes Gesicht auf.
Was sie denn bereits wüssten, fragte sie, weil man so anfing, indem man die Angehörigen einbezog. Die Angehörigen sahen stumm geradeaus auf einen Punkt oberhalb ihrer Nase. Betty räusperte sich, blickte in die Augen und tief in die Leben dieser drei Menschen für einen Moment. Sie senkte den Blick in die Patientenakte, räusperte sich, betrachtete die halbmondförmigen Abdrücke ihrer Daumennägel in der Kunststoffmappe. Sie hätten ja am Morgen bereits einen Anruf von der Klinik erhalten, fuhr sie fort, indem sie aufmunternd nickte.»Ja«, sagte die Tochter endlich, sie wüssten, dass ihre Mutter in der vergangenen Nacht eine neue Blutung bekommen habe und dass man nicht noch einmal operieren könne. Das Sprechen schien ihr große Mühe zu bereiten, denn ihr Mund vibrierte, und kaum wollten sich die Lippen zur Tätigkeit des Sprechens zusammenfinden.»Aber wir wissen nicht, was das heißt«, fügte sie hinzu, und die letzten Worte kippten nach hinten in ihren Hals zurück, in einem hell-blechernen Ton, den man kaum noch verstand und nur schwer von einem leisen Schrei unterscheiden konnte. Ein nicht nach außen zielendes, sondern ein umgekehrtes, in den eigenen Körper gerichtetes Schreien. Betty konnte ihr eigenes Blinzeln hören.
Es tue ihr leid, dass sie ihnen nichts Günstigeres berichten könne, sagte sie, was eine bewährte und oft gebrauchte Redewendung war. Wie sie schon wüssten, sei es nach der Notoperation zu einer weiteren Blutung gekommen, was sehr ungünstig sei. Sie sprach langsam, wie zu Schwerhörigen. Obwohl man durch die Schädelöffnung eine Druckentlastung bewirkt habe, sei die linke Gehirnhälfte durch die erneute Blutung deutlich angeschwollen. Aufgrund des künstlichen Komas könne man nicht feststellen, welche vegetativen Funktionen noch vom Organismus selbst übernommen würden, Atmung beispielsweise. Man werde die Patientin im Laufe der nächsten Tage von der Maschine nehmen, um das zu überprüfen. Alles in allem seien die Chancen, fuhr sie fort, nicht günstig bei einer solchen Schwellung des Gehirns, aber natürlich könne man nie wissen.
Читать дальше