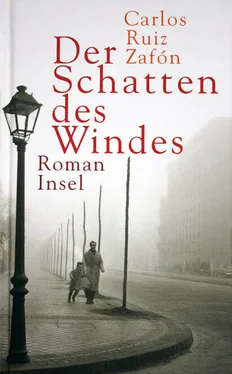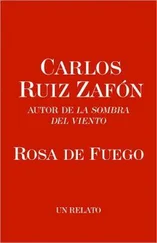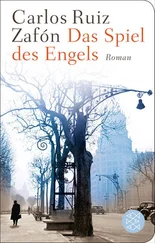Eines Tages war ich wie so oft auf Arbeitssuche gegangen, und bei meiner Rückkehr war Julián nicht da. Er kam erst am frühen Morgen wieder. Auf meine Frage, wo er gewesen sei, leerte er die Manteltaschen (der Mantel hatte Miquel gehört) und legte eine Handvoll Münzen auf den Tisch. Von da an ging er fast jede Nacht aus. In der Dunkelheit, einen Hut auf dem Kopf und in einen Schal gehüllt, mit Handschuhen und Mantel, war er ein Schatten unter Schatten. Nie sagte er mir, wohin er ging, fast immer aber brachte er Geld oder Schmuckstücke nach Hause. Er schlief vormittags, aufrecht in seinem Sessel sitzend und mit offenen Augen. Einmal fand ich in einer seiner Taschen ein Messer, eine zweischneidige Waffe mit automatischer Springfeder. Die Klinge war mit dunklen Flecken gesprenkelt.
In dieser Zeit hörte ich auf der Straße immer wieder Geschichten über einen Menschen, der nachts die Schaufensterscheiben der Buchhandlungen einschlug und Bücher verbrannte. Andere Male schlich sich der merkwürdige Vandale in eine Bibliothek oder in die Schatzkammer eines Sammlers. Immer nahm er zwei, drei Bücher mit und verbrannte sie. Einmal suchte ich ein Antiquariat auf und erkundigte mich, ob auf dem Markt irgendein Buch von Julián Carax zu finden sei. Der Verkäufer sagte, das sei unmöglich, jemand habe sie alle verschwinden lassen. Er habe selbst zwei besessen und sie einem seltsamen Mann mit vermummtem Gesicht verkauft, dessen Stimme kaum zu verstehen gewesen sei.
»Bis vor kurzem gab es noch einige Exemplare in Privatsammlungen, bei uns und auch in Frankreich«, sagte er, »aber viele Sammler stoßen sie inzwischen ab. Sie haben Angst, und ich kann es ihnen nicht verdenken.«
Manchmal verschwand Julián tagelang und dann bald für Wochen. Er ging und kam immer nachts, und immer brachte er Geld mit. Nie gab er eine Erklärung ab, und wenn er es einmal tat, erzählte er unsinnige Details. Er sagte, er sei in Frankreich gewesen, in Paris, Lyon, Nizza. Gelegentlich kamen Briefe aus Frankreich auf den Namen Laín Coubert, stets von Antiquaren, Sammlern. Jemand hatte ein verloren geglaubtes Exemplar eines von Julián Carax’ Werken ausfindig gemacht. Dann verschwand er mehrere Tage und kam zurück wie ein Wolf, stank nach Rauch und Rache.
Während einer seiner Abwesenheiten traf ich im Kreuzgang der Kathedrale auf den Hutmacher Fortuny. Er erinnerte sich noch an mich von dem Besuch her, den ich ihm vor zwei Jahren mit Miquel abgestattet hatte, um ihn nach Julián zu fragen. Er führte mich in einen Winkel und sagte mir vertraulich, er wisse, daß Julián am Leben sei, irgendwo, aber vermutlich sei es ihm aus einem bestimmten Grund, den er nicht erahnen könne, unmöglich, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
»Das muß irgendwas mit diesem Schuft von Fumero zu tun haben.« Ich sagte ihm, ich dächte genauso. Die Kriegsjahre erwiesen sich als sehr ergiebig für Fumero. Seine Allianzen wechselten von Monat zu Monat, von den Anarchisten zu den Kommunisten und von diesen zu dem, was sich gerade anbot. Die einen wie die andern bezeichneten ihn als Spion, Häscher, Helden, Mörder, Verschwörer, Intriganten, Retter oder Demiurgen. Spielte keine Rolle. Fürchten taten ihn alle. Alle wollten ihn auf ihrer Seite haben. Vielleicht zu sehr beschäftigt mit den Intrigen im Kriegsbarcelona, schien er Julián vergessen zu haben. Möglicherweise vermutete er, wie der Hutmacher, er sei geflohen und längst nicht mehr in seiner Reichweite.
Señor Fortuny fragte mich, ob ich eine alte Freundin seines Sohnes sei, was ich bejahte. Er bat mich, von Julián zu erzählen, von dem Mann, zu dem er geworden war, er selbst kenne ihn nicht, wie er mir traurig gestand.
»Das Leben hat uns auseinandergerissen, müssen Sie wissen.« Er hatte in sämtlichen Buchhandlungen Barcelonas nach Juliáns Romanen gesucht, hatte sie aber nicht finden können. Jemand hatte ihm erzählt, ein Verrückter klappere die Landkarte nach ihnen ab, um sie zu verbrennen. Fortuny war überzeugt, der Schuldige könne niemand anders als Fumero sein. Ich widersprach ihm nicht und log das Blaue vom Himmel herunter, aus Mitleid oder aus Verbitterung, ich weiß es nicht. Ich sagte, meiner Meinung nach sei Julián nach Paris zurückgegangen, es gehe ihm gut und ich sei überzeugt, er achte den Hutmacher sehr und werde zu ihm zurückkommen, sobald die Umstände es erlaubten.
»Es ist dieser Krieg«, klagte er, »der alles kaputtmacht.« Bevor wir uns auf Wiedersehen sagten, wollte er mir unbedingt noch einmal seine Adresse und auch die seiner ehemaligen Frau Sophie geben, mit der er nach langen Jahren der
»Mißverständnisse« den Kontakt wiederaufgenommen hatte. Sie lebe jetzt in Bogotá mit einem angesehenen Arzt zusammen, leite ihre eigene Musikschule und erkundige sich in ihren Briefen immer nach Julián.
»Das ist noch das einzige, was uns verbindet, wissen Sie. Die Erinnerung. Man macht in seinem Leben viele Fehler, Señorita, und merkt es erst, wenn man alt ist. Sagen Sie, sind Sie gläubig?«
Ich verabschiedete mich von ihm mit dem Versprechen, ihn und Sophie zu informieren, wenn ich etwas von Julián höre.
»Nichts würde seine Mutter glücklicher machen, als wieder von ihm zu hören. Frauen achten mehr aufs Herz und weniger auf Dummheiten«, schloß er traurig.
»Darum leben sie länger.«
Obwohl ich so viele böse Geschichten über ihn gehört hatte, konnte ich nicht umhin, mit diesem armen Greis Mitleid zu empfinden. Ich hatte ihn mir als rohen Kerl vorgestellt, als gemeinen, unverträglichen Menschen, aber er erschien mir als gutmütiger Mann, wenn auch blind, verloren wie alle. Vielleicht weil er mich an meinen eigenen Vater erinnerte, der sich vor allen und vor sich selbst in diesem Refugium von Büchern und Schatten versteckte, vielleicht weil uns auch der heftige Wunsch verband, Julián zurückzubekommen, gewann ich ihn lieb und wurde zu seiner einzigen Freundin. Ohne daß Julián etwas davon wußte, besuchte ich ihn oft in seiner Wohnung in der Ronda de San Antonio. Der Hutmacher arbeitete nicht mehr.
Er erwartete mich meistens am Donnerstag und servierte mir Kaffee, Kekse und Süßigkeiten, die er kaum anrührte. Stundenlang erzählte er mir von Juliáns Kindheit, wie sie zusammen in der Hutmacherei gearbeitet hatten, und zeigte mir Fotos. Er führte mich in Juliáns Zimmer, das er in makellosem Zustand bewahrte wie ein Museum, legte mir alte Hefte und unbedeutende Gegenstände vor, die für ihn wie Reliquien eines Lebens waren, das es nie gegeben hatte, und merkte nicht, daß er sie mir bereits früher gezeigt, daß er mir die ganzen Geschichten schon einmal erzählt hatte. An einem solchen Donnerstag begegnete ich auf der Treppe einem Arzt, der eben bei Señor Fortuny gewesen war. Ich fragte ihn nach dem Gesundheitszustand des Hutmachers, und er schaute mich argwöhnisch an.
»Sind Sie eine Angehörige von ihm?«
Ich sagte, von allem, was der arme Mann habe, komme ich dem wohl am nächsten. Da eröffnete mir der Arzt, Fortuny sei sehr krank und habe höchstens noch ein paar Monate zu leben.
»Was hat er denn?«
»Ich könnte Ihnen sagen, es ist das Herz, aber was ihn umbringt, ist die Einsamkeit. Erinnerungen sind schlimmer als die Wunden des Krieges.«
Als er mich erblickte, freute sich der Hutmacher und sagte, dieser Arzt sei nicht vertrauenswürdig, Ärzte seien doch nichts als Hampelmänner einer fragwürdigen Wissenschaft. Allenthalben sehe er die Hand des Teufels, der Teufel trübe den Verstand und führe die Menschen ins Verderben.
»Schauen Sie bloß den Krieg, und schauen Sie mich an. Jetzt wirke ich alt und schlaff, aber als junger Mann war ich ein echter Schurke und sehr niederträchtig.«
Einmal sagte ich zu Julián, falls er seinen Vater lebend wiedersehen wolle, müsse er sich beeilen. Da stellte sich heraus, daß auch er seinen Vater besucht hatte, ohne daß der es wußte. Aus der Ferne, in der Dämmerung, am andern Ende eines Platzes sitzend, wo er zuschaute, wie der Hutmacher alt wurde. Julián war es lieber, daß der Alte die Erinnerung an seinen Sohn mitnahm, die er damals in seinem Kopf geschmiedet hatte, und nicht die Wirklichkeit, zu der er geworden war.
Читать дальше