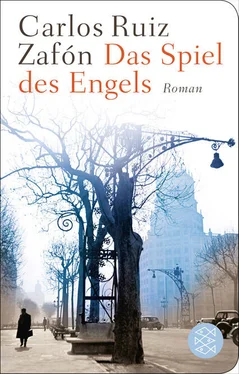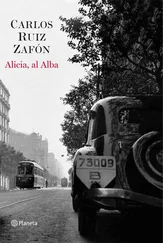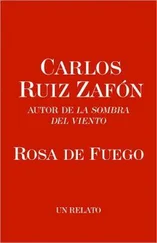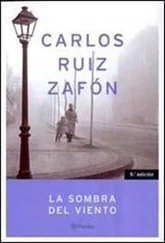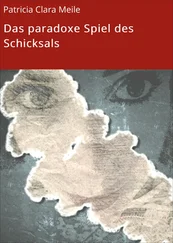»Ich suche das Familiengrab der Marlascas.«
»In weniger als einer halben Stunde ist es dunkel. Sie kommen besser an einem anderen Tag wieder.«
»Je eher Sie mir sagen, wie ich es finde, desto eher gehe ich auch wieder.«
Er schaute in einem Verzeichnis nach und zeigte mir dann mit dem Finger den Standort auf einem Plan an der Wand. Ohne mich zu bedanken, ging ich davon.
Unschwer fand ich im Gewirr von Gräbern und Mausoleen die Marlasca-Gruft. Die Anlage ruhte auf einem Marmorsockel und war von einer Kuppel überspannt, auf der sich eine ebenfalls marmorne, geschwärzte Gestalt erhob. Ihr Gesicht war von einem Schleier verhüllt, aber wenn man sich dem Familiengrab näherte, hatte man den Eindruck, diese jenseitige Schildwache drehe den Kopf und verfolge einen mit den Augen. Die Jugendstilgruft war wie ein Amphitheater in einem Rund aus zwei großen Treppenaufgängen angelegt, die zu einer Säulengalerie hinaufführten. Ich stieg eine der Treppen empor und blieb vor der Galerie stehen, um zurückzuschauen. In der Ferne sah man durch den Regen hindurch schwach die Lichter der Stadt.
Ich betrat die Galerie. Sie war von Grabplatten gesäumt. Im Zentrum stand eine Frauenstatue, die flehentlich ein Kreuz umarmte. Ihr Gesicht war durch Schläge verunstaltet worden, und jemand hatte ihre Augen und Lippen schwarz angemalt, was ihr etwas Wölfisches verlieh. Es war nicht das einzige Zeichen von Schändung der Grabstätte. Den Grabplatten waren mit einem spitzen Gegenstand Kratzer oder Markierungen zugefügt worden, und auf einigen sah man obszöne Zeichnungen und Wörter, die im Halbdunkeln kaum zu entziffern waren. Diego Marlascas Grab befand sich ganz hinten. Ich ging hin und legte die Hand auf die Grabplatte. Dann zog ich sein Bild hervor, das mir Salvador gegeben hatte, und betrachtete es.
Da hörte ich Schritte hinter mir auf der Treppe. Ich steckte das Bild wieder in den Mantel und ging auf den Eingang der Galerie zu. Die Schritte waren verstummt, und man hörte nur noch den Regen auf den Marmor prasseln. Langsam näherte ich mich dem Eingang und schaute hinaus. Die Gestalt hatte mir den Rücken zugewandt und betrachtete die Stadt in der Ferne. Es war eine Frau in Weiß, die den Kopf mit einem Tuch bedeckt hatte. Langsam wandte sie sich um und sah mich an. Sie lächelte. Trotz all der Zeit, die vergangen war, erkannte ich sie sofort — Irene Sabino. Ich tat einen Schritt auf sie zu und begriff erst da, dass sich noch jemand hinter meinem Rücken befand. Beim Schlag auf den Hinterkopf blitzte weißes Licht auf. Ich sank in die Knie und brach eine Sekunde später auf dem nassen Marmor zusammen. Im Regen zeichnete sich eine dunkle Gestalt ab. Irene kniete sich neben mir nieder. Ich spürte, wie ihre Hand meinen Kopf umfasste und die Stelle des Schlages ertastete. Als sie die Finger zurückzog, waren sie blutig. Sie streichelte mir damit übers Gesicht. Das Letzte, was ich sah, ehe ich das Bewusstsein verlor, war, dass sie ein Rasiermesser hervorzog und langsam aufklappte. Silberne Regentropfen glitten über die Schneide, während sie sie mir näherte.
Ich öffnete die Augen im blendenden Licht einer Öllampe und sah in das Gesicht des Aufsehers. Er betrachtete mich vollkommen ausdruckslos. Ich versuchte zu blinzeln, während mir eine Stichflamme aus Schmerz vom Nacken her durch den Schädel schoss.
»Leben Sie?«, fragte der Aufseher so teilnahmslos, dass ich nicht wusste, ob die Frage mir galt oder rein rhetorisch war.
»Ja«, stöhnte ich. »Stecken Sie mich ja nicht in irgendein Loch.«
Er half mir, mich aufzurichten. Jeder Zentimeter wurde mit einem Stich im Kopf beantwortet.
»Was ist geschehen?«
»Das müssten Sie doch wissen. Ich hätte schon vor einer Stunde schließen sollen, aber als Sie nicht aufgetaucht sind, bin ich hergekommen, um zu gucken, was los ist, und dann habe ich Sie gefunden, wie Sie hier Ihren Rausch ausschlafen.«
»Und die Frau?«
»Welche Frau?«
»Es waren zwei.«
»Zwei Frauen?«
Ich verneinte.
»Können Sie mir beim Aufstehen helfen?«
Mit seiner Unterstützung gelang es mir, mich zu erheben. Da spürte ich das Brennen und sah, dass mein Hemd offen war. Mehrere oberflächliche Schnitte liefen über meine Brust.
»Oioioi, das sieht aber gar nicht gut aus…«
Ich knöpfte den Mantel zu und tastete dabei nach der Innentasche. Marlascas Bild war verschwunden.
»Haben Sie Telefon in der Loge?«
»Ja, es steht im Saal mit dem türkischen Bad.«
»Dann können Sie mir vielleicht wenigstens behilflich sein, zur Torre de Bellesguard zu kommen, damit ich dort ein Taxi bestellen kann?«
Der Aufseher fluchte und stützte mich unter den Achseln.
»Ich hab Ihnen ja gesagt, Sie sollen an einem anderen Tag wiederkommen.«
Es war wenige Minuten vor Mitternacht, als ich endlich beim Haus mit dem Turm ankam. Sowie ich die Tür aufschloss, wurde mir klar, dass Isabella nicht mehr da war. Der Klang meiner Schritte im Korridor hatte ein anderes Echo. Ich machte gar nicht erst Licht, sondern ging im Halbdunkeln zu ihrem Zimmer und schaute hinein. Sie hatte sauber gemacht und alles aufgeräumt. Laken und Decken lagen peinlich genau zusammengefaltet auf einem Stuhl, die Matratze war unbezogen. Noch roch es nach Isabella. In der Veranda setzte ich mich an den Schreibtisch, den sie benutzt hatte. Sie hatte die Bleistifte gespitzt und fein säuberlich in ein Glas gestellt. Auf einem Tablett stapelten sich weiße Blätter. Die Schreibgarnitur, die ich ihr geschenkt hatte, stand daneben. Noch nie war mir die Wohnung so leer vorgekommen.
Im Bad zog ich die nassen Kleider aus und versorgte meinen Hinterkopf mit einem in Alkohol getränkten Wundverband. Der Schmerz war zu einem dumpfen, einem gewaltigen Kater nicht unähnlichen Pochen abgeklungen. Im Spiegel sahen die Schnitte auf der Brust wie mit der Feder gezogene Linien aus. Sie waren sauber und oberflächlich, brannten aber höllisch. Ich reinigte sie mit Alkohol und hoffte, dass sie sich nicht entzündeten.
Dann legte ich mich ins Bett und deckte mich mit mehreren Decken bis zum Hals zu. Die einzigen nicht schmerzenden Stellen meines Körpers waren die, welche Kälte und Regen bis zur Gefühllosigkeit betäubt hatten. Ich wartete darauf, dass mir wärmer wurde, und lauschte dieser kalten Stille, dieser Abwesenheit und Leere, die die Wohnung erstickte. Isabella hatte das Bündel mit Cristinas Briefen auf meinen Nachttisch gelegt. Ich streckte die Hand aus und nahm aufs Geratewohl einen. Er war zwei Wochen alt.
Lieber David,
die Tage vergehen, und ich schreibe dir weiterhin Briefe, die du vermutlich nicht beantworten willst, wenn du sie denn überhaupt öffnest. Mittlerweile denke ich, ich schreibe sie nur für mich, um die Einsamkeit zu vertreiben und einen Augenblick lang zu glauben, du seist bei mir. Jeden Tag frage ich mich, wie es dir wohl geht, was du wohl tust.
Manchmal denke ich, du habest Barcelona verlassen, um nie mehr zurückzukehren, und stelle dich mir irgendwo unter Fremden vor, wie du ein neues Leben beginnst, von dem ich nie etwas erfahren werde. Dann wieder denke ich, dass du mich noch hasst, dass du diese Briefe vernichtest und mich am liebsten niemals kennengelernt hättest. Ich gebe dir keine Schuld. Seltsam, wie leicht man, wenn man allein ist, einem Blatt Papier anvertraut, was jemandem ins Gesicht zu sagen man sich nicht trauen würde.
Ich habe es nicht leicht. Pedro könnte nicht liebenswürdiger und verständnisvoller sein mit mir. Er ist es so sehr, dass mich seine Geduld manchmal aufbringt, und sein Wunsch, mich glücklich zu machen, bewirkt nur, dass ich mich desto elender fühle. Er hat mir gezeigt, dass mein Herz leer ist, dass ich niemandes Liebe verdiene. Er verbringt fast den ganzen Tag bei mir, weil er mich nicht allein lassen mag.
Читать дальше