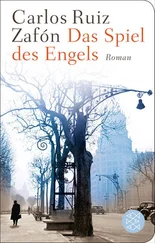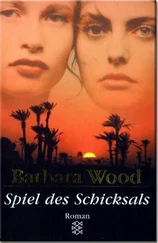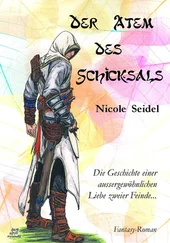Patricia Clara Meile
Das paradoxe Spiel des Schicksals
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Patricia Clara Meile Das paradoxe Spiel des Schicksals Dieses ebook wurde erstellt bei
1 Schule des Leidens
2 Geister und Parallelwelten
3 Der erste Mann
4 Farben der Rebellion
5 Kleine Schwester
6 Verlassen
7 Erfahrungen in der Fremde
8 Konflikte und Freundschaft
9 Folter der Liebe
10 Land des Lächelns
11 Abgrund
12 Erdbeerkuss
13 Zerplatzte Träume
14 Hadern
15 In den Armen des Feindes
Impressum neobooks
„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.“ „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Dies sind Sprichworte, die mich tief geprägt haben. Sie werden mich wohl für den Rest meines Lebens begleiten. Die Menschen, die mir am allernächsten standen, haben mich eiskalt belogen, Familienmitglieder sowie Lebensgefährte. Es sind die Menschen, auf die du baust, denen du erst mal blind vertraust, insbesondere der Familie im Sinne von „Blut ist dicker als Wasser“. Doch mein naives Grundvertrauen in die Menschen ist dahin. Wenn selbst engste Verwandtschaft und Partner dir ohne Wimpernzucken ins Gesicht lügen können, wem sonst sollst du dann noch trauen?
Eigentlich habe ich aufgrund der Erlebnisse in meiner Kindheit und Jugend ein außergewöhnlich starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Ich lechze richtiggehend danach, mich anlehnen zu können, mich selbst zu sein und mich sogar auch ein Stück weit gehen lassen zu können. Oberflächliche Bekanntschaften sagen mir nicht viel. Ich bevorzuge es, einige wenige Menschen um mich zu haben, die mir wirklich etwas bedeuten und mit denen ich ungehemmt über alles reden kann. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir, aus tiefem Begehr nach Bestätigung und Ehre, von meiner ganzen Umgebung akzeptiert zu werden und mich Ansehen und Beliebtheit zu erfreuen.
Wenn ich die Augen schließe, mich nach innen kehre, ganz tief in mich hineinsehe, erkenne ich deutlich diese endlose Leere, dieses schwarze Nichts, in dem meine wunde Seele wie ein hilfloses Staubkorn in einer düsteren bedrohend stillen Nacht herumgetrieben wird. Meine Kehle schnürt sich zusammen. Meine Augen schmerzen von all den vergossenen Tränen, für die ich solche Scham empfinde und von denen dennoch nicht genug geflossen zu sein scheinen. Mein ganzer Leib zittert vor eisiger Kälte. Brechreiz überkommt mich. Mein Schädel pocht und mein Nacken knackst bei der kleinsten Bewegung. Horche ich jetzt in das Innere dieser sinnlosen hässlichen Hülle, die man meinen Körper schimpft, höre ich das müde Schlagen des Herzens und das vergebliche Schreien meiner Seele: „Lass mich gehen! Ich will weg von hier! Ich will tot sein! Lockere deine Krallen! Hör auf, dich an diesem Leben festzuklammern!“ „Ich will das nicht“, rede ich mir ein. Nein, ich habe nicht den Mut dazu. Ich bin schwach und feige. Ich tauge selbst nicht dazu, ein Ende zu setzen. Ich befinde mich in einem Haus, in dem tagtäglich hunderte von Menschen ein- und ausgehen und doch bin ich so allein. Ich glaube mich hier einsamer zu fühlen, als an jedem anderen Flecken auf dieser Erde. Das Zittern wird immer stärker. Die Getränkeflasche auf meinem Pult bewegt sich im Takt dazu. Die Kälte rinnt tiefer in mich hinein, bis ich die eisigen Tropfen auf meiner Seele spüre. Ich habe niemanden, mit dem ich reden und lachen kann, niemanden, den ich meinen Freund oder meine Freundin nennen kann. Warum? Was mache ich bloß falsch? Ich bin krank. Ich bin nicht normal. Ich bin depressiv. Ich will sterben und will es doch nicht. Irgendwo scheint noch etwas zu sein, an dem mir liegt, von dem ich mich nicht lösen kann. Ach, würde ich doch nur erkennen, was es ist! Vielleicht bekäme dann alles wieder einen Sinn. Ich sitze da und starre zu Boden. Das Bild vor meinen Augen verschwimmt. Die Struktur des Linoleumbelages flimmert in nervösen wellenartigen Bewegungen. Mir ist so schlecht, so schwindlig. Eigentlich sollte ich essen. Es ist Mittag. Wenn ich jetzt nicht esse, werden meine Schläfen noch mehr pochen. Lese ich, als inzwischen erwachsene Frau, diese bitteren Zeilen eines jungen verzweifelten Mädchens, geschrieben während einer Mittagspause in einem verlassenen Schulzimmer, berührt mich das sehr. Mein Herz wird von Trauer und Mitleid erfüllt.
Ich schätze meine Freundschaften heute wahrscheinlich mehr wie manch anderer. Ich war ein uncooles Kind und eine uncoole Jugendliche, ein Opfer extremsten Mobbings bis hin zu allnächtlichem Aufschrecken aus dem Schlaf und abrupten Erbrechen. Ich kotzte alles Leid heraus. Das Erbrochene wurde weggewischt und die Gründe wurden ignoriert. Weder Lehrpersonen noch Eltern haben sich ernsthaft mit meiner Situation befasst oder sich für mich und für eine Lösung eingesetzt. Später leugnete meine Familie gar, diesen Psychoterror mitgekriegt zu haben, obschon mein junger Körper keine deutlicheren Hilfeschreie von sich hätte geben können – lächerlich und an Dreistigkeit kaum zu übertreffen. Ich wurde einfach als schwierige Halbwüchsige abgetan, mit der man nicht umgehen konnte. Obendrein wurde ich hart dafür mit Bildungs- und Liebesentzug bestraft. Das würde ich ihnen wohl nie verzeihen können.
Ein katholischer Prediger sagte einst, man solle immer wieder neu Maß nehmen. Ich befand diesen Leitsatz damals für gut und verinnerlichte ihn mir lange. Auch heute noch bin ich der Ansicht, dass jeder eine zweite und vielleicht auch eine dritte Chance verdient hat, aber irgendwann ist das Maß voll, irgendwann ist einfach zu viel passiert, um wiederholt barmherzig vergessen und vergeben zu können. Selbstverständlich spielt das Ausmaß der zu verzeihenden Handlungen eine wesentliche Rolle. Kleinere, alltägliche Fehler begehen wir schließlich alle immer wieder. Es sind die wirklich groben, um die es geht.
Der erste Schultag an der Oberstufenschule in der nächstgelegenen Stadt war der Beginn eines neuen Lebensabschnittes, auf den ich mich ebenso gefreut, wie ich mich auch davor gefürchtet hatte. Zwanzig neue Gesichter mit genauso vielen neuen Charakteren, die mein Leben von nun an prägen würden. Doch ich ahnte nicht wie sehr . Ich war ein scheues Mädchen mit langen Haaren und damals noch plumpen, unförmigen Kleidern. Davor auf dem Dorfe hatten Kleider, Marken und Stilrichtungen keine Rolle gespielt. Meine Haltung war geduckt und verriet jedem, der es zu sehen wünschte, mein mangelndes Selbstvertrauen. Ich bewegte mich unsicher und zögernd. Das kam besonders im Sportunterricht zur Geltung. Heute würd da ich nicht mehr hingehen, damit mich die Sportlehrer gar nicht erst kennenlernten. Sport gehörte ohnehin nicht zum Notendurchschnitt. Ich gehörte zu der Sorte, die stets als letzte gewählt wurde, wenn es um die Bildung der Gruppen für Mannschaftsspiele ging. Meine Unbeholfenheit sorgte gleichermaßen für Ärger und für Belustigung. Ich redete sehr wenig und leise mit einem leichten, kaum hörbaren Zittern in der Stimme. Mein Tonfall war monoton, mein Sprechrhythmus langsam und nicht selten verhaspelte ich mich. Ich war alles in allem das perfekte Opfer, ein kleines graues Mäuschen, das man rücksichtslos niedertrampeln und zerquetschen konnte – eine Zielscheibe von Demütigungen.
Infolgedessen war ich bald alleine, alleine gegen hunderte von anderen Jugendlichen. Ich war an der ganzen Schule bekannt – hässlich, schüchtern, unbeholfen, doof und unbeliebt, aber vor allen Dingen hässlich. Ich war ein Mauerblümchen und hatte große Zähne, die in alle Himmelsrichtungen standen. Bloß als Kind im Babyalter muss ich unglaublich hübsch gewesen sein. Ich war ein Säugling mit vielen dunklen Locken auf dem Kopf und großen mit endlos langen Wimpern umrahmten Augen. Wenn die Schwestern in der Klinik den frisch gebackenen jungen Eltern präsentierten, wie man ein Kind wiegt, wäscht, wickelt und füttert, wählten sie stets mich als Vorführobjekt. Meine Eltern waren total stolz gewesen. Sie erzählten immer wieder gerne davon. Über viele Jahre hatte ich in meinem Kinderzimmer ein vergrößertes schwarzweißes Baby-Foto hängen. Leider ließ diese engelsgleiche Schönheit rasch nach.
Читать дальше