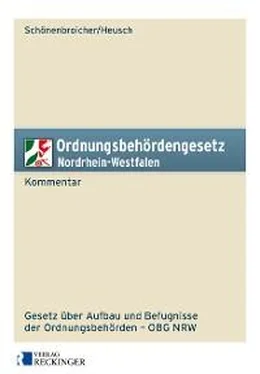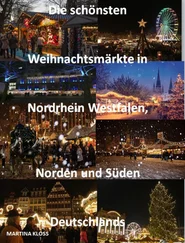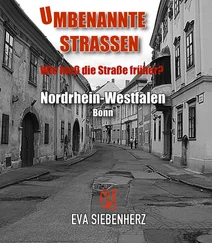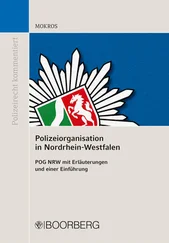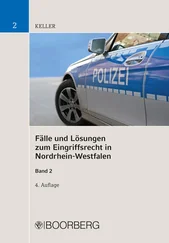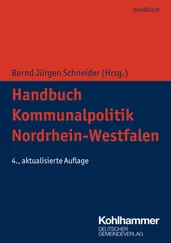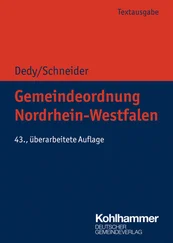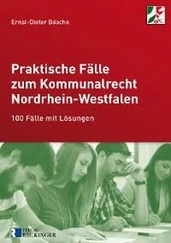11
Ein alter Streitpunkt war dabei, in welcher rechtlichen Rahmenstruktur und mit welchen Weisungsrechten übergeordneter Stellen diese Aufgaben wahrzunehmen seien. Während von kommunaler Seite schon immer die Forderung nach weitgehender Ingerenzfreiheit erhoben wurde, kann es nicht verwundern, dass Stimmen, die eher der staatlichen Praxis verpflichtet waren, für ein durchaus kräftiges Weisungsrecht eintraten, um einen recht- und gleichmäßigen Aufgabenvollzug im ganzen Land (vor 1945: Preußen, dann: Nordrhein-Westfalen) sicherzustellen. Die „Tradition des staatlichen Polizeimonopols“ war ein „preußisches Dogma“, allerdings ein recht umstrittenes und nicht zu allen Zeiten geltendes[26]. War vor der Steinschen Städteordnung die „gute polizey“ lange Zeit Selbstverwaltungsangelegenheit der Städte[27], setzte sich im 19. Jahrhundert in der preußischen Staatspraxis, in Rechtsprechung und Gesetzgebung immer mehr die Meinung durch, dass die Polizei ausschließlich staatliche, nicht kommunale Angelegenheit sei[28]. Dementsprechend bestimmte § 1 des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes in bemerkenswerter Klarheit: „Die Polizei ist Angelegenheit des Staates“[29], und so lautet heute noch § 1 POG: „Die Polizei ist Angelegenheit des Landes“[30].
12
Polizeikommunalisierungen durch die britische Besatzungsmacht zwischen 1945 und 1951[31], anfangs nicht einmal publiziert[32], in der Begründung kaum überzeugend und in der Durchführung zum Teil ungeordnet und unklar[33], blieben Episode[34]. Der erste NRW-Innenminister, Walter Menzel (SPD), arbeitete darauf hin, die Polizei unter die Kontrolle der Landesregierung bzw. des Innenministers zu stellen, dabei orientierte er sich an der preußischen Polizei unter Carl Severing; er betonte auch die Notwendigkeit der zivilen Führung der Polizei[35]. Staatliche Polizeibehörden auf der Ausgangsstufe sind die Polizeipräsidien und die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden. Die Ordnungsbehörden dagegen sind kommunale Behörden (sog. echte Kommunalisierung), auch eine Folge des Polizeikompromisses der Landesregierung (Innenminister Franz Meyers, CDU) mit den Kommunen aus dem Jahre 1953: staatliche Polizei, kommunale Ordnungsbehörden[36].
13
Unklar und sehr lange umstritten war, welche Verwaltungstätigkeiten zu dem Begriff „Polizei“ im Einzelnen zu zählen waren. Schon 1932 merkte Franzen in seinem Kommentar zum PVG an, die Gemeinden übten gewisse „Polizeigebiete als Selbstverwaltungsangelegenheiten aus, z. B. die Aufsicht nach dem Geschlechtskrankheitengesetz und die Wohnungsaufsicht“[37]. Das Problem der Reichweite des Polizeibegriffs (im Sinne der Gefahrenabwehr, nicht der Wohlfahrtsverwaltung[38]) und der „Entpolizeilichung“ von Rechtsmaterien, die wir heute als Besonderes Verwaltungsrecht (Eingriffs- oder sogar Leistungsverwaltung, Sonderordnungsrecht in der Terminologie des § 12) bezeichnen würden, traf sich an diesem Punkt mit der Frage, ob und welche staatlichen oder kommunalen Behörden für welche Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständig sein sollten[39]. Bei der Abfassung des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes von 1931 wurde intensiv um diese Fragen gerungen[40], und nach 1945 setzten sich die Diskussionen fort, beschleunigt durch die unklaren und unausgereiften Kommunalisierungsbestrebungen der Besatzungsmächte[41]: „Dass die Polizei in Deutschland für Aufgaben der Bauverwaltung oder der Gewerbeaufsicht zuständig war, konnten die Amerikaner nicht verstehen. Polizei war für sie gleichbedeutend mit Uniform und möglicher Anwendung von körperlichem Zwang.“[42] In Deutschland dagegen gab es – jedenfalls bis vor 1918 – alle möglichen sogenannten „Polizei“rechtsmaterien, sogar die „Gesindepolizei“, die sich um das Führen der „Gesindedienstbücher“ durch das „Gesinde“ kümmerte[43]. Es war „schulpolizeilich“ verboten, Schulkinder während der Schulzeit mit Arbeiten zu beschäftigen etc.[44].
14
Bedenkt man, dass sich schon 1956 weite Bereiche des heute sogenannten „Besonderen Verwaltungsrechts“ aus dem früheren „Polizeirecht“ im Wege der „Entpolizeilichung“ heraus entwickelt hatten[45] und diese Aufgaben von kommunalen Behörden vollzogen wurden, konnte der nordrhein-westfälische Gesetzgeber nicht bei der pauschalen Aussage bleiben, „die“ Polizei sei Angelegenheit des Landes. Ihm stellte sich vielmehr die Aufgabe, die nicht zum engeren Polizeibegriff gehörenden, von kommunalen Stellen wahrgenommenen Aufgaben der „Gefahrenabwehr“ (Eingriffsverwaltung, sog. materieller Polizeibegriff[46]) in einer rechtlichen Form zu regeln, welche einerseits den staatlichen Aufsichts-, Steuerungs- und Überwachungsinteressen entsprach, andererseits mit der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie (Art. 78 Abs. 2 bis 4 LV) vereinbar war. Man greift daher zu kurz, reduziert man die Trennung von Ordnungsbehörden- und Polizeirecht nach 1945 nur auf Vorgaben und Verfügungen der Besatzungsmächte[47]. Rietdorf hat in der ersten Auflage seines Kommentars festgehalten: „Der seit Jahrhunderten, ja eigentlich von Anfang an, in Gang befindliche Verengungsprozeß des Polizeibegriffs ist auch heute noch nicht abgeschlossen. An die Stelle der Generalermächtigung des Staates zur Gefahrenabwehr, die es gestattete – unter Umständen nach wechselndem Ermessen –, abgeschlossene Lebensbereiche im Verordnungswege zu regeln, ist in zunehmenden Maße die spezialgesetzliche Behandlung zusammengehöriger Sachgebiete getreten.“[48] Rechtsstaatlich ging es um Präzisierung, weg von der Generalklausel – rechtsförmlich jedoch wollte der OBG-Gesetzgeber zur Wahrung der allgemeinen Prinzipien ein Grundgesetz der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr schaffen, mit umfassender Gültigkeit (§ 1) nicht nur für das Recht der allgemeinen Ordnungsbehörden, sondern auch für die sich fachlich immer stärker ausdifferenzierenden neuen Stammnormen auf den Feldern des Sonderordnungsrechts (§ 12).
15
Sehr kompliziert geworden ist die Regelung der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und die Übertragung dieser Kunstfigur in das Ordnungsbehördenrecht. Das aufgabenmonistische Verständnis des Art. 78 Abs. 2 und 4 LV und die einfachrechtliche Umsetzung dieser verfassungsrechtlichen Lehre – oder, je nach Betrachtungsweise: Irrlehre – in Landesorganisationsgesetz, Kreisordnung, Gemeindeordnung und Ordnungsbehördengesetz machen den nordrhein-westfälischen Staatsaufbau unangemessen schwer verständlich. Der Aufgabenmonismus („Weinheimer Entwurf“) geht gedanklich nicht von einer staatlichen Zuweisung von Aufgaben an die Kommunen aus, sondern von gewissermaßen originären, vorgefundenen kommunalen Aufgaben, bei denen nur eng begrenzte staatliche Aufgabenzuweisungen als verfassungsrechtlich zulässig vorgestellt werden können[49]. Danach sind jedoch weder die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben noch die Bundesauftragsverwaltung und die Fachweisungsrechte beim Vollzug von Bundesrecht (Art. 84, 85 GG) dogmatisch hinreichend erklärbar. Die Ansicht dürfte kaum mit der grundgesetzlichen Regelung vereinbar sein, wonach die Kommunen Teil der Verwaltungsebene der Länder sind[50]. Der grundgesetzliche Begriff der Selbstverwaltung in Art. 28 Abs. 2 GG kann als Grundlage für den Aufgabenmonismus nicht herangezogen werden[51]. Rechtsmaterien wie etwa das Ausländerrecht sind unter keinem Gesichtspunkt (rein) örtliche Angelegenheiten, welche (nur) die gerade mehr oder weniger zufällig zuständige Ortsgemeinde oder Kreisebene als Sonderordnungsbehörde[52] im „eigenen“ Wirkungskreis angehen würden. Im Grunde ist der Aufgabenmonismus ein Relikt aus der Besatzungszeit nach 1945[53] (vor Gründung der Länder und Einrichtung der Bundesrepublik als Gesamtstaat) und staatsrechtlich nicht zu begründen[54].
16
Folge der Ausgestaltung der ordnungsbehördlichen Gefahrenabwehraufgaben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sind nicht nur dogmatische Unklarheiten und Streitigkeiten bis heute[55]. Auch die komplizierte Architektur des zurückgenommenen sonderaufsichtlichen Fachweisungsrechts in den §§ 9 ff. ist Ergebnis der monistischen Grundanlage des OBG[56]. Dabei bedürfte es der dogmatischen Figur der Pflichtaufgaben und des Aufgabenmonismus weder, um die Zulässigkeit der Zurücknahme des Fachweisungsrechts des Staates auf bestimmten Feldern nach den Kriterien des § 9 zu begründen[57], noch, um z. B. den kommunalen Regelvollzug auf der Ausgangsstufe in NRW zu rechtfertigen. Einigkeit besteht heute darin, dass die Kommunen bei Weisungen jedenfalls klagebefugt sind[58].
Читать дальше