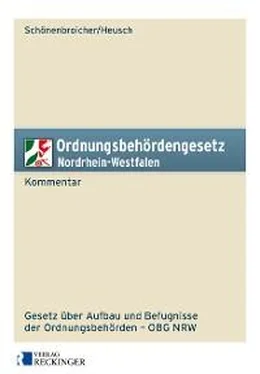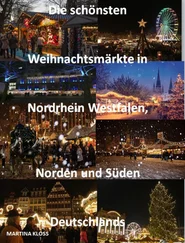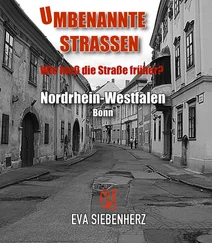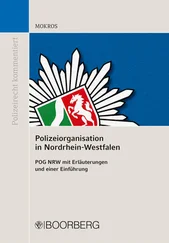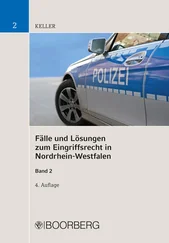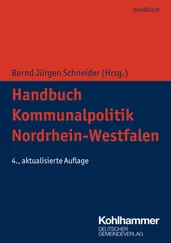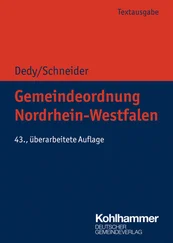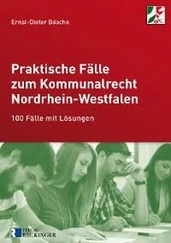Schönenbroicher
I. Rechtsgrundlagen des Ordnungs- und Polizeirechts in Nordrhein-Westfalen
1
Die Herausbildung und Verfeinerung rechtsstaatlicher Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945 kann man besonders gut am Beispiel des Polizei- und Ordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen verfolgen[1]. Rechtsgrundlage für die Gefahrenabwehr war zunächst das Preußische Polizeiverwaltungsgesetz (PVG) vom 1. Juni 1931[2] (in der Fassung der Bekanntmachung der für den Aufgabenbereich der Polizei geltenden Neufassung des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes vom 27. November 1953[3]), in Verbindung mit dem Gesetz über die Organisation und die Zuständigkeit der Polizei im Lande Nordrhein-Westfalen (POG) vom 11. August 1953[4].
2
Mit dem „Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG)“ – vom 16. Oktober 1956 hat der Landesgesetzgeber den Versuch unternommen, ein allgemeines „Grundgesetz“ für den gesamten Bereich des Rechts der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zu schaffen, in dem nicht nur Organisation und Handlungsformen, sondern auch grundlegende Fragen des staatlichen oder kommunalen Verwaltungsvollzugs (Art. 78 LV) und der Aufsicht geregelt wurden. Der Landesgesetzgeber hat dabei von der grundgesetzlich verliehenen Rechtsetzungsmacht für das Ordnungsrecht Gebrauch gemacht (Art. 70 Abs. 1 GG)[5].
3
Die Leistung des Gesetzgebers des OBG erscheint umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass die allgemeine (administrative) Landesorganisation – einfachrechtlich, auf der Grundlage des Art. 77 Satz 1 der Landesverfassung NRW – erst 1962 in dem Landesorganisationsgesetz (LOG) geregelt wurde. Die allgemeine Vorschrift zur Regelung des Verfahrens, das Verwaltungsverfahrensgesetz (Bund und Land), erging gar erst 1976, obgleich ein Bund-Länder-Ausschuss unter nordrhein-westfälischer Leitung schon 1963 einen entsprechenden Musterentwurf vorgelegt hatte[6]. Der Gesetzgeber des OBG hat also in mancherlei Hinsicht juristisches Neuland betreten, was das rechtsstaatlich geprägte Recht der Gefahrenabwehr unter dem freiheitlichen Regime von Grundgesetz und Landesverfassung angeht, und mancher Regelungen haben später in das allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz Eingang gefunden[7]. All dies entsprach der Absicht seiner Schöpfer: Rietdorf hat im Vorwort zur ersten Auflage seines Kommentars (1957) darauf aufmerksam gemacht, es komme nicht darauf an, das Recht der Gefahrenabwehr zu „verbesondern“, sondern zu „verallgemeinern“[8], das moderne Ordnungsbehördengesetz „fülle eine in der Praxis seit langem empfundene Lücke“[9].
4
Das OBG wurde seitens der Landesregierung am 12. Februar 1954 erstmals in den Landtag eingebracht[10], unter dem 9. September 1954 ein zweites Mal[11]. Es wurde zweimal neu bekanntgemacht (1969[12] und 1980[13]). Die Änderungen seit 1980 lassen sich in der kostenlosen Elektronischen Sammlung des Landesrechts verfolgen[14].
5
Das Gesetz liegt in seinen wesentlichen Vorschriften noch heute unverändert vor: Auch dies ein Gütezeichen, was die Durchdachtheit der Vorschriften und die Formulierungskunst seiner Schöpfer angeht; auf die wenigen Kritikpunkte im Einzelnen wird in diesem Kommentar hingewiesen.
6
Das Recht der polizeilichen Gefahrenabwehr findet sich im Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003[15]. Hinsichtlich der Organisation der Polizei wurde – als eine Art Spezialvorschrift zum Landesorganisationsgesetz (LOG) – ein eigenes Gesetz erlassen[16]: das Gesetz über die Organisation und Zuständigkeit der Polizei im Lande Nordrhein-Westfalen – Polizeiorganisationsgesetz (POG NRW) –, in der Bekanntmachung der Neufassung vom 5. Juli 2002[17].
7
Ferner hat der Landesgesetzgeber eine Reihe von Spezialnormen im Bereich des engeren Sicherheitsrechts geschaffen, von denen an erster Stelle das Verfassungsschutzgesetz zu nennen ist[18]. Auf das von Bund und Ländern in der Zwischenzeit erlassene Sonderordnungsrecht des Besonderen Verwaltungsrechts wird insbesondere bei §§ 1, 3 und 12 eingegangen.
II. Ziele, Zweck und Regelungsstruktur des Ordnungsbehördengesetzes
1. Grundsatzgesetzgebung
8
Erstens soll das Gesetz das Grundgerüst, die Grundsatzgebung für Organisation, Zuständigkeiten und Eingriffsrechte der Ordnungsbehörden – im Sinne der Eingriffsverwaltung – in Nordrhein-Westfalen bilden. Dass ein Staat solche Grundsatzgesetze im organisatorischen Bereich vorhält, ist nicht selbstverständlich, und allgemein-rechtsdogmatisch ist die Kategorie der einfachrechtlichen Grundsatzgesetze sicher auch nicht unbedenklich[19]. Dem nordrhein-westfälischen Landesorganisationsgesetzgeber jedoch ist eine durch Grundsätze – und nicht durch Wildwuchs – geprägte Landesorganisation seit 1946 durchgehend ein Anliegen. Die mancherorts (auch in der Staatsrechtswissenschaft) zu hörende Einschätzung, es gebe im Wesentlichen kein Organisationsrecht der Länder, deren Organisation müsse gar als ungeordnet bezeichnet werden, trifft für Nordrhein-Westfalen nicht zu[20]. Bedenklich erschiene allenfalls, dass es für die Polizeiorganisation ein separates Gesetz gibt; diese Regelungen gehörten wohl in das Polizeigesetz und das LOG.
2. Bewahrung und Verstärkung rechtsstaatlicher Prinzipien in der Eingriffsverwaltung
9
Zweitens sollten mit dem OBG die „rechtsstaatlichen Errungenschaften“ des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes von 1931 nicht nur bewahrt, sondern „übernommen und teilweise noch verstärkt“ werden[21]. Aus heutiger Sicht ist erstaunlich, dass das Handeln der allgemeinen Verwaltung noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einmal in den Grundzügen gesetzlich geregelt, sondern nach ungeschriebenen, zum Teil umstrittenen und unklaren allgemeinen Rechtsgrundsätzen „organisiert“ war. Das OBG füllte für die Eingriffsverwaltung diese Gesetzeslücke zumindest zum Teil aus (etwa § 20 Abs. 1 bis 3 in der Ursprungsfassung: Schriftform, Bestimmtheitserfordernis – jetzt § 37 Abs. 1 VwVfG). Zugleich führte es die großen Errungenschaften des preußischen Polizeirechts des Kaiserreichs und der Weimarer Republik fort[22]. Es ging um die rechtsstaatliche Einhegung, ja „Zähmung“ der Gefahrenabwehrbehörden, indem diesen klare, vor allem limitierende gesetzliche Handlungsvorgaben gemacht wurden (materieller Polizeibegriff). Hierzu gehören insbesondere die Trennung von Aufgaben- und Befugnisnorm (§§ 1, 14) sowie die Ausformulierung und verbindliche Geltung des Verhältnismäßigkeitsprinzips[23]. Besonders wichtig auch die Verpflichtung der Ordnungsbehörde, die Rechtsgrundlage ihres Handelns anzugeben, was den heilsamen Zwang auslöst, sich zuvor darüber klar zu werden, „ob die Maßnahme auf Grund einer generellen oder speziellen Ermächtigung oder auf Grund beider erlassen wird“[24]. Die Vorschriften im OBG sind demgemäß zu Recht nicht ausschließlich als Rechtssätze, sondern auch und gerade als rechtsstaatliche Erinnerungen und Ermahnungen und praktische Handlungsanweisungen an die Adresse der gesetzesausführenden Behörden gedacht.
3. Die Verschränkung mit dem Aufsichtsproblem („Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung“)
10
Drittens wurden mit dem OBG offenkundig auch kommunalverfassungsrechtliche Regelungsabsichten verfolgt bzw. politische Kompromisse der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden in Gesetzesform gegossen. Im Hintergrund steht, dass es in Nordrhein-Westfalen schon seit der legendären Steinschen Städteordnung aus dem Jahre 1808[25] eine (parteiübergreifende) Tendenz gibt, den Ausgangsvollzug auf der untersten Ebene nicht versäulten staatlichen Sonderverwaltungen anzuvertrauen, sondern vor allem kommunalen Einrichtungen, in den heutigen Organisationsformen also den Gemeinden und Kreisen.
Читать дальше