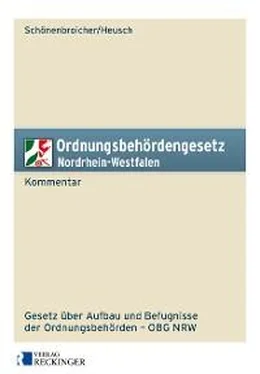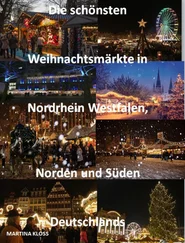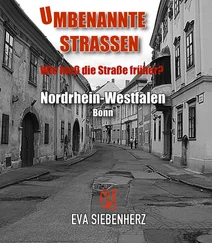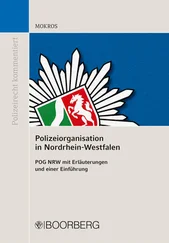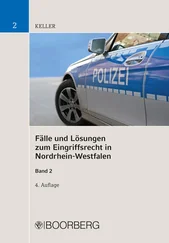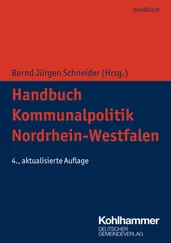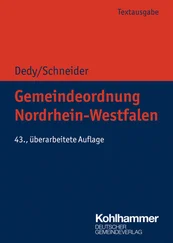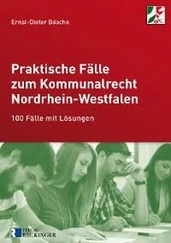Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Einleitung
I.Rechtsgrundlagen des Ordnungs- und Polizeirechts in Nordrhein-Westfalen
II.Ziele, Zweck und Regelungsstruktur des Ordnungsbehördengesetzes
1.Grundsatzgesetzgebung
2.Bewahrung und Verstärkung rechtsstaatlicher Prinzipien in der Eingriffsverwaltung
3.Die Verschränkung mit dem Aufsichtsproblem („Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung“)
III.Regelungsstruktur und wesentliche Regelungen des Gesetzes
IV.Zukunft des Ordnungsrechts
1.Gesellschaftspolitische Dimension
2.Sicherheitspolitische Dimension
Teil I Aufgaben und Organisation der Ordnungsbehörden
§ 1 Aufgaben der Ordnungsbehörden
I.Allgemeines zum Anwendungsbereich des OBG
1.Regelungstechnik des Gesetzgebers in § 1
2.Zuständigkeiten bei Gefahr im Verzug und Selbstverständnis der Ordnungsbehörden
II.Absatz 1
1.Allgemeines
2.Begriff der „Gefahr“
3.Störung
4.Schaden
5.Weitere Ausprägungen des Gefahrbegriffs im Rahmen von § 1 Absatz 1
6.Gefahrenverdacht, Gefahrerforschungseingriff
7.Gefahrenvorsorge
8.„Gefahrenarten“ des Gefahrenabwehrrechts: Tatbestandsvoraussetzungen und Eingriffsschwellen („Gefahrstufen“)
a.Konkrete Gefahr
b.Abstrakte Gefahr
c.Gegenwärtige Gefahr
d.Gefahr im Verzug
e.Dringende Gefahr
f.Erhebliche Gefahr
g.Gemeine Gefahr
h.Weitere spezialgesetzliche Eingriffs- bzw. Handlungsvoraussetzungen
9.Schutzgut: öffentliche Sicherheit
a.Unverletzlichkeit der Rechtsordnung
b.Bestand und Einrichtungen des Staates
c.Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen
10.Schutzgut: öffentliche Ordnung
a.Definition
b.Rechtspolitischer Streit um verfassungsrechtliche Zulässigkeit und Angemessenheit
III.Spezialgesetzliche Zuständigkeiten, Subsidiarität, Absatz 2
1.Allgemeines
2.Materien im Einzelnen
IV.Absatz 3
§ 2 Vollzugshilfe der Polizei
I.Allgemeine Abgrenzung: Zuständigkeit der Polizei und der Ordnungsbehörden
II.Schreibtischarbeit hier – Unaufschiebbarkeit dort
III.Weitergabe von Eingaben und Anzeigen etc.
IV.Pflicht der Polizei zur Vollzugshilfe
V.Ordnungspartnerschaft
VI.Verhältnis Vollzugshilfe – Amtshilfe
§ 3 Aufbau
I.Allgemeines
II.Begriff der örtlichen Ordnungsbehörden
III.Offene Aufgabenzuschreibung
IV.Begriff der „Sonderordnungsbehörde“
V.Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
VI.Auftragsangelegenheiten nach Bundes- bzw. Landesrecht
VII.Abgrenzung der Zuständigkeiten der Ordnungsbehörden zu anderen Zuständigkeiten bei sog. Großveranstaltungen
VIII.Landesordnungsbehörden (Absatz 2)
§ 4 Örtliche Zuständigkeit
I.Allgemeines
II.Ortsprinzip
III.Fälle aus der Rechtspraxis
IV.Rechtsfolgen bei Verletzung der Zuständigkeitsvorschrift
§ 5 Sachliche Zuständigkeit
I.Allgemeines
II.Sachlich-instanzielle Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörde (Ortsprinzip)
III.Ausnahme vom allgemeinen Ortsprinzip (Absatz 2)
IV.Grundsatz der einheitlichen Zuständigkeit
V.Absatz 3
VI.Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die sachliche Zuständigkeit
§ 6 Außerordentliche Zuständigkeit
I.Allgemeines
II.Absatz 1
III.Absatz 2
IV.Absatz 3
§ 7 Aufsichtsbehörden
I.Allgemeines
II.Regelungsfelder der Sonderaufsicht
III.Hierarchische Gliederung der Aufsichtsverwaltung
IV.Zusammenarbeitsregelungen
§ 8 Unterrichtungsrecht
I.Allgemeines
II.Rangfolge von Aufsichtsmitteln, Ermessen
III.Unterrichtungsrecht und Unterrichtungspflicht
§ 9 Weisungsrecht gegenüber örtlichen und Kreisordnungsbehörden
I.Allgemeines
II.Absatz 1: Rechtmäßigkeit
1.Legalitäts- oder Opportunitätsprinzip?
2.Pflicht zur Beanstandung
III.Absatz 2: Zweckmäßigkeit
1.Vorrangige Regelungen, ausgeschlossene Gesetzgebungsfelder
2.Begrenztheit des Fachweisungsrechts
3.Absatz 2 Buchstabe a)
4.Absatz 2 Buchstabe b)
IV.Absatz 3
V.Absatz 4
VI.Absatz 5
VII.Durchsetzung der Weisungen
VIII.Rechtsschutz gegen Aufsichtsmaßnahmen nach § 9 und Haftung
§ 10 Selbsteintritt
I.Allgemeines
II.Einzelfragen
§ 11 Befugnisse der Kommunalaufsichtsbehörden
I.Allgemeines
II.Durchsetzung fachaufsichtlicher Weisungen durch die Kommunalaufsicht
§ 12 Sonderordnungsbehörden
I.Allgemeines
II.Einzelne Rechtsmaterien
III.Anwendbarkeit ordnungsbehördlicher Vorschriften auf Sonderordnungsbehörden (Absatz 2)
§ 13 Dienstkräfte der Ordnungsbehörden
I.Allgemeines
II.Satz 1
III.Satz 2
IV.Satz 3
Teil II Befugnisse der Ordnungsbehörden
Abschnitt 1 Ordnungsverfügungen
§ 14 Voraussetzungen des Eingreifens
I.Allgemeines
1.Historische und verfassungsrechtliche Einordnung
2.Handlungsform Ordnungsverfügung – „Maßnahme“
3.„Im einzelnen Falle“
4.Generalklausel, gefahrenabwehrrechtliche „Standardmaßnahmen“, Verfügungen auf der Grundlage ordnungsbehördlicher Verordnungen (§ 25)
5.Inhaltliche Bestimmtheit der Maßnahme
6.Anzeige- und Genehmigungspflichten
7.Beweislast
II.Absatz 1
1.Gefahr bzw. Störung
2.Öffentliche Sicherheit oder Ordnung
3.Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Ordnungsverfügung
4.Duldungspflichten des Bürgers
5.Duldung durch die Behörde
III.Absatz 2
IV.Kasuistik zu § 14 (nach in der Verwaltungspraxis relevanten Stichworten geordnet)
V.Durchsetzung der Ordnungsverfügung – Verwaltungszwang nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
1.Rechtsgrundlage des Verwaltungszwangs: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW in Verbindung mit der Ausführungsverordnung
2.Gestreckter Vollzug (§ 55 Abs. 1 VwVG) der ordnungsbehördlichen Verfügung
3.Unmittelbare Ausführung (§ 55 Abs. 2 VwVG) der ordnungsbehördlichen Verfügung
4.Zwangsmittel
5.Zusammenhang von Grundverfügung, Verwaltungszwang und Kostenbescheid
§ 15 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
I.Grundlagen
1.Zur Terminologie
2.Herleitung, Bedeutung und Rang des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
3.Anwendungsbereich
4.Gestufte Verhältnismäßigkeitsprüfung
II.Gestufte Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
1.Verfolgung eines legitimen Zwecks
2.Grundsatz der Eignung
3.Grundsatz der Erforderlichkeit
4.Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne
III.Rechtsfolge eines Verstoßes und gerichtliche Kontrolle
IV.Einzelfälle aus verschiedenen Bereichen
§ 16 Ermessen
I.Historie
II.Allgemeines
III.Die Bedeutung des Zwecks der Ermessensermächtigung und der sonstigen ermessensleitenden Gesichtspunkte für die Rechtmäßigkeit des Ermessenshandelns
IV.Ermessensfehler
1.Allgemeines
2.Ermessensüberschreitung
a.Allgemeines
b.Ermessensüberschreitung durch Ermessensausübung bei Ermessensreduzierung auf Null
3.Ermessensunterschreitung bzw. Ermessensnichtgebrauch
4.Ermessensfehlerhaftigkeit „im engeren Sinne“, Ermessensfehlgebrauch
Vor § 17 Allgemeines zur ordnungsrechtlichen Verantwortlichkeit
I.Der Verantwortliche: „Störer“
II.Polizeipflichtigkeit der Hoheitsträger
III.Allgemeine Regeln der Störerauswahl nach Ermessen – Effektivität der Gefahrenabwehr
IV.Kostentragungspflicht des Störers
§ 17 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen
I.Absatz 1
1.Begriff der Verhaltensverantwortlichkeit
2.Begriff der Verursachung
Читать дальше